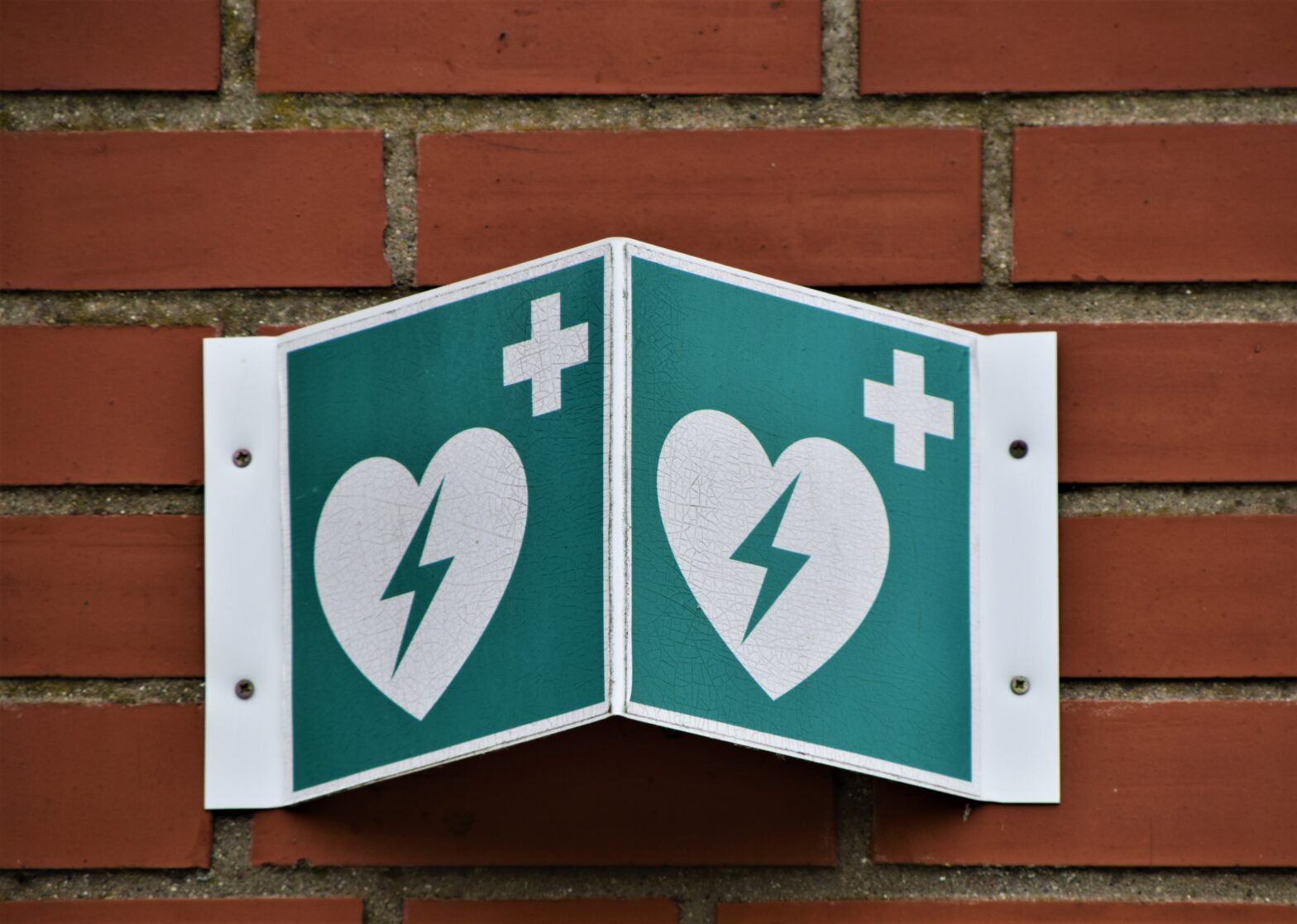Aktie Twitter Facebook Email Copy URL
Linke Perspektiven auf eine neue Sicherheitsarchitektur
Der brutale russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat, anders als etwa die seit Jahren geführten und immer noch andauernden brutalen Kriege im Jemen oder in Syrien, durch seine Plötzlichkeit, aber sicher vor allem dadurch, dass er mitten in Europa stattfindet und über die sozialen Medien nonstop in die Wohnzimmer der Menschen übertragen wird, eine Reihe liebgewonnener Gewissheiten über Frieden und Sicherheit zerstört: Das Konzept der einstigen neuen Ostpolitik, das Egon Bahr 1963 mit der Tutzinger Rede einführte und das Wandel durch Annäherung oder Handel versprach, gilt nicht mehr. Und das linke Versprechen von Russland als Friedensmacht, die Teil einer europäischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur werden müsse, schon gar nicht.
Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg hat in kürzester Zeit viel in Bewegung gesetzt. Nicht nur die Solidarität der europäischen Bevölkerung gegenüber den mittlerweile rund 10 Millionen Geflüchteten innerhalb der Ukraine und den fast 4 Millionen Geflüchteten, die das Land in die Nachbarländer und von dort weiter in verschiedene europäische Länder verlassen haben, scheint grenzenlos zu sein – und das in allen europäischen Ländern, anders als noch 2015. Auch die Einigkeit der Länder der Europäischen Union scheint so groß zu sein, wie schon lange nicht mehr, wie die schnellen Entscheidungen für Wirtschaftssanktionen gegen Russland oder die Einreise von ukrainischen Geflüchteten in die Europäische Union ohne Registrierung zeigen.
In der politischen Linken in Deutschland hingegen herrschte nach wochenlangem Streit über die Haltung zu Putin und die Rolle der NATO erst in dem Moment Einigkeit, als Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung die Entscheidung für ein 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr bekannt gab. Die Erhöhung der deutschen Rüstungsausgaben im Zuge des Ukraine-Krieges mit der Begründung abzulehnen, dass es keine breite demokratische Diskussion gab und dass – unter Einhaltung der Schuldenbremse – massive Einschnitte im sozialen, kulturellen und öffentlichen Bereich folgen werden, ist natürlich richtig und gut. Glaubwürdig wird das Ganze aber nur, wenn gleichzeitig Fragen wie die nach einem europäischen Sicherheitskonzept, oder besser noch einer europäischen und globalen Friedensordnung, angegangen werden.
Das Kartenhaus, in dem die Linke die Welt seit dem Ende des Kalten Krieges in den imperialistischen Akteur USA/NATO/NATO-Mitgliedsstaaten und die Zielscheiben der imperialistischen Politik – Russland und China und ihre Einflusssphären – aufgeteilt hat, ist in den frühen Morgenstunden des 24. Februar 2022 innerhalb weniger Minuten zusammengebrochen. Für die politische Linke ergeben sich daraus mindestens zwei Notwendigkeiten. Zum einen muss sich die Linke über die Möglichkeiten der zivilen Konfliktbearbeitung hinaus erstmals auch mit Fragen der Landes- und Bündnisverteidigung auseinandersetzen. Es reicht nicht aus, den Fehler einzugestehen, dass die deutsche Linke in den letzten Jahren die realen Sicherheitsbedenken der osteuropäischen Staaten einfach ignoriert und die damit verbundenen Bündnisinteressen aufgrund der angeblichen Sicherheitsinteressen Russlands als NATO-Osterweiterung kategorisch verurteilt und damit abgelehnt hat. Es bedarf einer Diskussion darüber, wie diesen Sicherheitsinteressen, die durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine keineswegs geringer geworden sind, in Zukunft Rechnung getragen werden kann. Dazu gehört auch eine Analyse und Diskussion darüber, wie es um die Landesverteidigung in Deutschland bestellt ist. Einerseits räumen Teile der Linken ein, dass die Ukraine auch ein Opfer des russischen Angriffs geworden ist, weil sie nicht Teil der NATO ist. Im gleichen Atemzug wird aber die NATO als ein Relikt des 20. Jahrhunderts dargestellt, das Teil des Problems und nicht der Lösung ist. Das ist nach außen hin nicht nachvollziehbar, vor allem dann nicht, wenn nicht gleichzeitig darüber diskutiert wird, wie die Landes- und Bündnisverteidigung in Europa außerhalb der NATO organisiert werden kann.
In der gegenwärtigen Situation ist es weder politisch noch gesellschaftlich anschlussfähig, eine europäische Verteidigungsunion und eine Zusammenarbeit zwischen NATO und Europäischer Union wie vor dem Krieg alternativlos abzulehnen. Stattdessen sollte die politische Linke Vorschläge für ein Sicherheitssystem in den Diskurs einbringen, das linken Kriterien entspricht, indem es beispielsweise einer starken parlamentarischen Kontrolle unterliegt und Rüstungsexporte ablehnt. Eine Möglichkeit wäre ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit, das auf der Verpflichtung zum gegenseitigen Beistand auf der Grundlage von Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags in Übereinstimmung mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen beruht. Oder wir könnten darüber nachdenken, den OSZE-Prozess zwischen der Europäischen Union als solcher und den Nachbarstaaten wiederzubeleben, anstatt zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den Nachbarn. Beides bedeutet im Übrigen nicht, dass der Grundsatz, dass Krieg kein Mittel der Politik sein darf, nicht mehr gilt. Im Gegenteil: Abrüstung muss ein zentraler Bestandteil einer neuen Friedens- und Sicherheitsordnung sein, gerade auch im Hinblick auf die aktuellen deutschen und internationalen Aufrüstungsinitiativen. Dies wird aber nur im globalen Maßstab und damit nur zu gegebener Zeit funktionieren. Der Verhandlungsprozess des Atomwaffensperrvertrags (NPT) durch den Achtzehn-Nationen-Ausschuss für Abrüstung in Genf kann hierfür als Beispiel dienen.

Über die Debatte um die neue europäische Sicherheits- und Friedensordnung hinaus sollte die politische Linke in Deutschland aus Gründen der Prävention künftiger Konflikte weitere, bisher nicht angesprochene Punkte in die Diskussion einbringen. Auch wenn die EU-internen Streitigkeiten, die es vor dem Ukraine-Krieg gab, Stichwort Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, vorerst leiser geworden sind, sollte das Fenster der Gemeinsamkeiten genutzt werden, um sie zu lösen. Und auch andere offene Konfliktlinien sollten angesprochen werden. Dazu gehört die Diskussion über den Umgang mit der EU-Beitrittsperspektive von Albanien, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Serbien der Europäischen Union beitreten will, aber gleichzeitig keinen Ärger mit Russland bekommen möchte. Das Problem der Staatenlosen in Lettland muss angegangen werden, denn es ist einfach nicht hinnehmbar, dass 30 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mehr als 200.000 russischsprachige Menschen in Lettland keine Staatsbürgerschaft haben. Eine europäische Perspektive ist neben der Ukraine auch für Moldawien und Georgien erforderlich. In diesem Zusammenhang sollte bereits heute ein Fonds für den Wiederaufbau der Ukraine und die Stabilisierung der gesamten Region diskutiert werden. Und auch für alle anderen Probleme der Europäischen Union, insbesondere für die Themen Asyl, Migration, Grenzmanagement, müssen Lösungen gefunden werden, wenn Konflikte in Zukunft wieder zivil gelöst werden oder möglichst gar nicht erst entstehen sollen.
Denn diese Krise ist nur eine von mehreren Krisen, die wir in den nächsten Jahren bewältigen müssen und die neben anderen Problemen zu noch größeren Geflüchtetenbewegungen führen werden als jetzt. Die Klimakrise hat bereits einige Teile der Erde unbewohnbar gemacht. Nach Angaben des Institute for Economics & Peace (IEP) könnten extreme Wetterverhältnisse, steigende Meere und geschädigte Ökosysteme dazu führen, dass bis 2050 weltweit 1,2 Milliarden Menschen vertrieben werden. Laut Welternährungsprogramm (WFP) hat die weltweite COVID-19-Pandemie dazu geführt, dass die Zahl der Menschen, die von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sind, seit 2019 von 135 Millionen auf 276 Millionen gestiegen ist. Da Russland der größte Weizenexporteur der Welt ist und die Ukraine der fünftgrößte, wird der Krieg in der Ukraine nach Prognosen der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) zu einem weiteren Anstieg der Zahl der hungernden Menschen führen – und das nicht nur in den bereits bestehenden Krisenregionen. Hinzu kommt die Krise des Artensterbens, die sich auch direkt auf den Menschen auswirkt, der am unteren Ende der Nahrungskette steht. Und dann ist da noch die Energiekrise, die sich bereits in Form von hohen Gas- und Ölpreisen bemerkbar macht, da versucht wird, die Energielieferungen aus Russland zu begrenzen, die aber in Zukunft noch ganz andere Auswirkungen haben könnte.
All diese Krisen erhöhen das weltweite Konflikt- und Eskalationspotenzial und haben in unserer globalisierten Welt auch direkte Auswirkungen auf den Frieden in Europa. Sie müssen daher Teil der Problembeschreibung und in der Folge auch Teil der zu entwickelnden Lösungsvorschläge werden. Die zweite Notwendigkeit besteht also darin, alles zu tun, um der multilateralen Ordnung die ihr gebührende Bedeutung zu verleihen, und zwar deshalb, weil es zu ihr keine Alternative gibt. Der gesamte Mechanismus der internationalen Zusammenarbeit ist durch die Ereignisse der letzten Wochen gestört worden, denn es findet ein Krieg statt, der von einem Mitglied des UN-Sicherheitsrates geführt wird, während ein anderes Mitglied schweigend daneben steht – also die Handlungen unterstützt. Die Ukraine ist zum Schauplatz eines Kampfes nicht nur zwischen Demokratien und Autokratien geworden, sondern eines Kampfes um die Aufrechterhaltung eines auf Regeln basierenden Systems, in dem die Interessen einzelner Länder nicht mit Gewalt durchgesetzt werden. Auch wenn die universellen Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen nach wie vor gültig sind, scheinen die Vereinten Nationen und das gesamte multilaterale System angesichts des russischen Angriffskrieges ohnmächtiger denn je. Just in dem Moment, als der UN-Sicherheitsrat am 24. Februar 2022 zusammentrat, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern, erklärte Putin der Ukraine den Krieg, woraufhin Russland sein Veto gegen die Resolution des UN-Sicherheitsrats einlegte, in der der Einmarsch in die Ukraine verurteilt wurde.
Dennoch zeigt die aktuelle Situation auch, wie wichtig internationale Institutionen wie die UN-Vollversammlung als Ort der Verhandlung sind. Es war eine gute Entscheidung, die Abstimmungen in der UN-Vollversammlung herbeizuführen, denn die Abstimmungen haben gezeigt, welche Staaten sich wie positionieren. Zukünftige Strategien müssen sich nun darauf konzentrieren, dieses regelbasierte System zu schützen und zu stärken. Es wird zu überlegen sein, welche Institution international vereinbarte Regeln in Kriegssituationen wie der aktuellen, aber auch bei anderen Regelverstößen wie durchsetzen kann. Es wird auch darum gehen müssen, was der Handlungsrahmen ist. Aus linker Sicht kann dies nur ein Handlungsrahmen sein, der das Völkerrecht und die Menschenrechte in den Mittelpunkt des politischen Handelns stellt. Das bedeutet auch, überall darauf hinzuweisen, dass die UN-Charta, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die beiden UN-Menschenrechtspakte nicht dem Westen oder dem Osten, dem Norden oder dem Süden vorbehalten sind, sondern dass ihr Schutz für alle Staaten verbindlich und grundlegend für die internationale Ordnung ist. Deshalb müssen auch andere Orte und Institutionen, die sich für den Schutz der Menschenrechte einsetzen, wie der UN-Menschenrechtsrat, gestärkt werden. Sie bieten auch in Kriegssituationen einen geschützten Rahmen für den Austausch über Weltregionen hinweg.
Wir werden diesen Austausch nicht nur in Fragen von Krieg und Frieden brauchen, sondern vor allem zur Bekämpfung der oben beschriebenen Menschheitskrisen. Eine bereits diskutierte Wende in der Energiewende hätte katastrophale klimapolitische Folgen. Warum nicht ein 30-jähriges Konfliktmoratorium zur Lösung der Klima- und Biodiversitätskrise fordern, um den dringend notwendigen Politikwechsel zu forcieren? In diesem Zusammenhang könnten die oben beschriebene notwendige Umstrukturierung der internationalen Institutionen vorangetrieben werden, aber auch konkrete Lösungsansätze erprobt werden. So könnten wir beispielsweise über globale Investitionsstrukturen sprechen, die Länder unterstützen, die vom Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen am stärksten betroffen sein werden. Einerseits, um die größte ökologische Transformation aller Zeiten zu meistern, aber auch, um zukünftige Kriege zu verhindern. Und um das Vertrauen der Gesellschaft in die Zukunft wiederherzustellen. Nach der jüngsten Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach hat der Krieg gegen die Ukraine zu einem in der deutschen Geschichte noch nie dagewesenen Einbruch des Zukunftsoptimismus geführt. Die Aufgabe linker Politik ist es, den Menschen die Angst zu nehmen. Menschen, die Angst um ihr Leben haben, sind für andere Themen nicht ansprechbar. Aus Angst erwächst kein Potenzial für eine emanzipatorische Gesellschaft.
Eva Wuchold, Programmleitung Soziale Rechte, Rosa Luxemburg Stiftung Genf Jan Leidecker, Büroleiter, Rosa Luxemburg Stiftung Genf