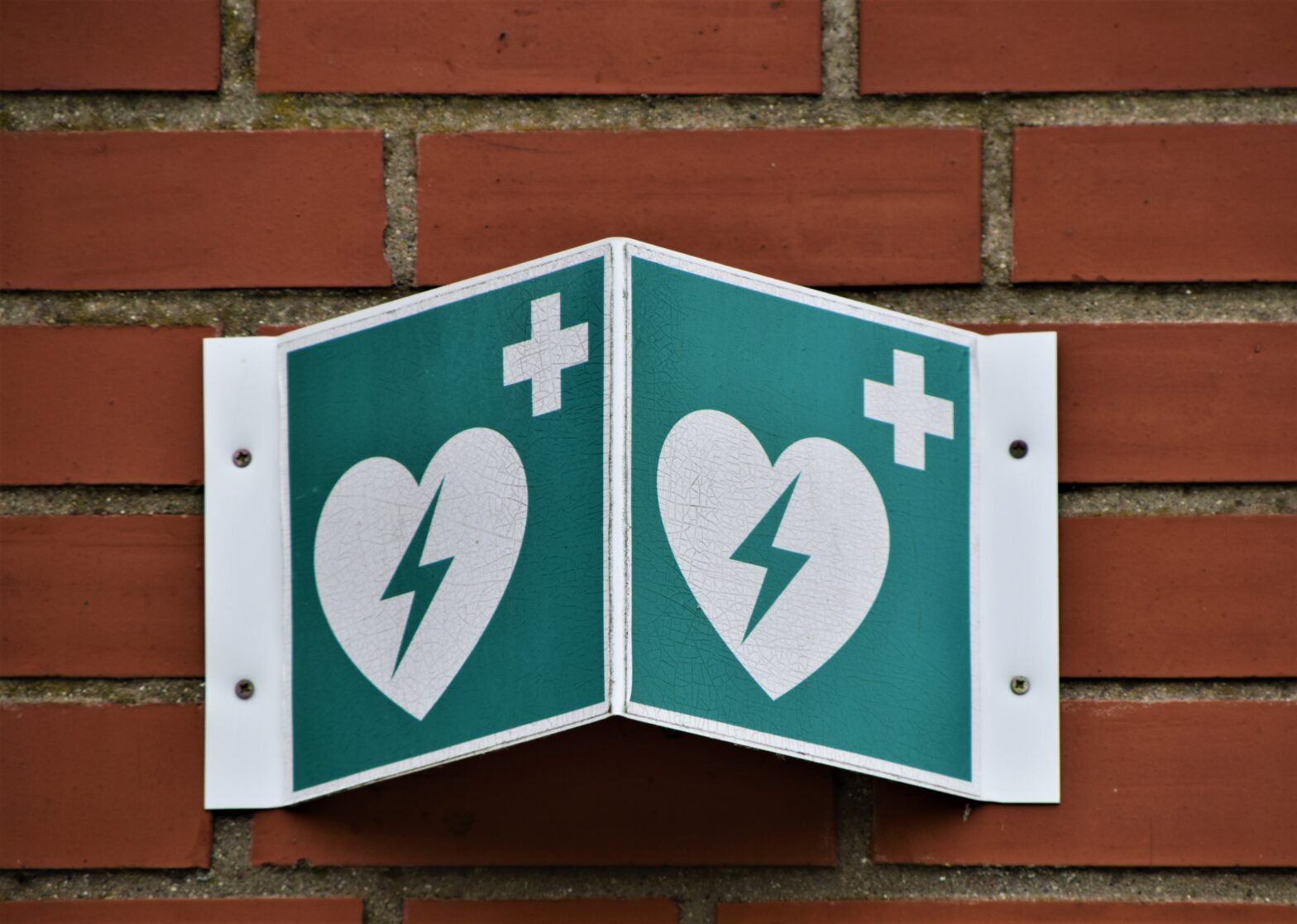Aktie Twitter Facebook Email Copy URL
Aspekte eines neuen Internationalismus – als ein Austausch der Erfahrungen, der Übernahme von Zielen, der gemeinsamen Aktivitäten.

Prof. Dr. Alex Demirović ist Senior Fellow am Institut für Gesellschaftsanalyse der Stiftung und arbeitet schwerpunktmäßig zu Fragen von Demokratie und Sozialismus.
People’s Climate March in Seattle/Washington, 2015. CC BY 2.0, Flickr: John Duffy
Der Internationalismus reicht lange zurück und hat sich in den vergangenen 200 Jahren mehrfach in seiner Gestalt und Funktion gewandelt. Dies hat dazu geführt, dass seine verschiedenen Formen, die Solidarität und Emanzipation ermöglichen sollen, sich durchaus auch immer wieder als Fessel erweisen und das Handeln begrenzen können. Deswegen ist es notwendig, die Ziele des Internationalismus, seine Konzepte und Praktiken selbst immer wieder kritisch zu überdenken und zu aktualisieren.
Dabei geht es nicht unbedingt darum, frühere Praktiken zu verwerfen, vieles kann kritisch bewahrt werden, anderes ist lehrreich – und doch kann es erforderlich sein, neue Praktiken zu entwickeln. Viele Schwierigkeiten hängen jedoch nicht vom guten Willen von internationalistischen Akteuren ab, sondern sind prinzipieller Natur und ergeben sich aus den Veränderungen der kapitalistischen Produktions- und der politischen Verhältnisse.
Der Internationalismus gehört konstitutiv zur bürgerlichen Gesellschaft und stellt eine Form der Auseinandersetzung mit ihrem Staat dar. Die Erklärung der Menschenrechte während der Französischen Revolution zielte als nationale Verfassung gleichzeitig auf die Menschheit. Vereint in einem Weltbürgertum, sollten alle in den Genuss von Freiheit, Gleichheit und Solidarität kommen. Das war konkret erfahrbar, denn viele französische Revolutionäre sahen sich eng verbunden mit der amerikanischen Revolution und revolutionären Bestrebungen auf dem europäischen Kontinent, auf den britischen Inseln und in den Kolonien. Eine ökonomisch-politische Form jenseits der feudalen Kleinstaaterei zeichnete sich ab. Wäre es nach den Revolutionären der Zeit gegangen, wäre die Nation nicht nationalstaatlich verfasst worden, sondern hätte zur Vereinigung des Dritten Standes geführt, also all derer, die den Reichtum der Gesellschaft erwirtschaften. Im Raum stand die Möglichkeit eines Weltstaats. Die restaurativen Kräfte in Großbritannien, Preußen, Russland, Österreich und schließlich auch in Frankreich zwangen dem Weltgeschehen mit ihrer (Un)ordnung imperiale Grenzziehungen auf, die nicht nur Europa, sondern den Globus aufteilten. Nicht die geeinte Menschheit, sondern die Kämpfe um Kontrolle und Einflusssphären wurden bestimmend und schufen die materielle Notwendigkeit für die emanzipatorischen und internationalistischen Bewegungen bis heute.
Bewusst reagierte die Internationale Arbeiter Assoziation in den 1860er Jahren darauf, dass «die Mißachtung des Bandes der Brüderlichkeit», die zusammenhanglosen Versuche der regionalen und nationalen Arbeiterbewegungen bei ihren Kämpfen für Emanzipation seit Ende des 18. Jahrhunderts immer wieder zu Niederlagen geführt hatten. Die herrschenden Klassen konnten die Freiheitskämpfe niederschlagen, Nationalvorurteile nähren, die Sklaverei verewigen. Dem wollte sich die Internationale mit einer Vereinigung der Arbeiterklasse entgegenstellen. Deren Emanzipation konnte keine lokale oder nationale, sondern eine soziale Aufgabe sein. Wahrheit, Gerechtigkeit und Sittlichkeit im Verhalten zu allen Menschen sei die Verhaltensregel – „ohne Rücksicht auf Farbe, Glauben oder Nationalität“.
Der grundlegenden Überlegung zufolge kennen die sozialistische und kommunistische Bewegung und ihre Trägergruppen kein Vaterland. Sie sind keinem besonderen Staat gegenüber gebunden und verfolgen keine nationalen Ziele. In den einzelnen Staaten sollten sich die zerstreuten Arbeitergesellschaften zu nationalen Vereinigungen verbinden, da allein die Kombination ihrer großen Zahl die Macht, Durchsetzungsfähigkeit und Koordination mit der Zentrale der Internationale ermöglichen würde. Zudem sollte sich die Kritik und die Praxis der Veränderung immer erst einmal auf den eigenen Staat und die jeweils herrschenden Gruppen beziehen. Dies liegt nahe, weil andernfalls die kritischen Kräfte sehr leicht für die Interessen und die politischen Ziele der nationalen Herrschaftsgruppen selbst instrumentalisiert werden können. Doch so leicht, wie die Erklärung der Internationale es nahelegt, war es nicht. Denn Nation, Hautfarbe oder Religion – und es kommen, wie die folgenden Jahrzehnte zeigen sollten, mit Geschlecht oder sexueller Orientierungen noch weitere hinzu – erwiesen sich als hartnäckig-eigensinnige Widerspruchsformen, die die soziale Emanzipation vielfach (durch)kreuzten.
Die entscheidenden Orientierungen für den Internationalismus, wie er im 20. Jahrhundert bestimmend wurde, haben sich sicherlich aus der russischen Revolution ergeben. Mit ihr hatte sich eine sozialistische Revolution gegen die restaurativen Kräfte von Adel und Bourgeoisie ebenso wie gegen die Achsenmächte Deutschland und Österreich und die Westalliierten behauptet. Verstanden wurde die russische Revolution als Beginn der Weltrevolution, internationalistische Solidarität bedeutete in diesem Sinn eine gemeinsame Politik für gemeinsame Ziele. Nach wenigen Jahren jedoch beschränkte sich der Internationalismus auf die Solidarität mit der Sowjetunion. Sie nahm die Form von materieller Hilfe oder die propagandistische Verteidigung des Sozialismus in einem Land an.
Hieraus ergaben sich in der Folge tragische Konflikte, denn es entstand eine Solidaritätsfalle: Linke Parteien ordneten sich der KPdSU und ihren Zielen unter. Linke sahen sich in die Alternative gezwungen, sich positiv zu identifizieren und zu verteidigen, auch wenn man Kritik hatte; von bürgerlicher Seite wurde verlangt, dass die Kritik mit einer Lossagung von sozialistischen Zielsetzungen verbunden war. Kritik an der Politik der KPdSU und an Stalin oder grundsätzlicher an überkommenen Vorstellungen innerhalb des Marxismus oder des Sozialismus wurden als Abweichung, Verrat, als Renegatentum, als konterrevolutionär oder gar als faschistisch denunziert. Die Partei oder die SU zu kritisieren, aus der Partei auszutreten oder von ihr ausgeschlossen zu werden, konnte für die Einzelnen bedeuten, ihr gesamtes soziales Umfeld zu verlieren; in der UdSSR konnte es Lagerhaft oder Tod bedeuten, was auf der Seite der Linken kaum ansprechbar war und die Solidarität mit Linken in anderen Regionen widersprüchlich macht und vergiftete.
Dies führte zu tiefen Gräben innerhalb der Linken nicht nur zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten, sondern zwischen einer Vielzahl von linken Strömungen. Viele, die mit internationalistischer Einstellung in Spanien an der Seite der Republik gegen den Franquismus kämpften, mussten erfahren, dass sie auch von stalinistischen Kräften bekämpft wurden; in den faschistisch beherrschten Ländern wurden Widerstandskämpfer aus der Linken von stalinistischen Organisationen denunziert. Solidarität konnte zur mörderischen Falle werden.
Die russische Revolution gab den Impuls zur Herausbildung nationaler Befreiungsbewegungen. Ihre Forderung nach Selbstbestimmung der Völker in den Kolonialgebieten war vielfach verbunden mit sozialistischen Zielen. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand der Internationalismus in weitem Maße darin, solchen Bewegungen aus den imperialistischen Zentren heraus Unterstützung zu geben. Dies bedeutete, die Ziele dieser Bewegungen bekannt zu machen, über die ausbeuterischen und rassistischen Verhältnisse zu informieren, denen die Menschen in den Kolonien unterworfen waren und den Bewegungen bzw. ihren Vertretern materielle Hilfe zu geben. Die Befreiungskämpfe kamen häufig in die Konstellation eines Stellvertreterkonflikts zwischen der Sowjetunion und den kapitalistischen Zentren, die mit der staatlichen Eigenständigkeit eine Ausdehnung des Kommunismus befürchteten und deswegen mit dem Ziel der Eindämmung entweder selbst militärisch eingriffen oder antikommunistische Politik unterstützten. Indien, China, Kuba, Algerien, Vietnam, Angola, Mozambik, Eritrea – der Befreiungskampf, der in den imperialistischen Zentren von vielen Protestbewegungen umfangreich unterstützt wurde, war im Wesentlichen bis Mitte der 1970er Jahren abgeschlossen.
Für die internationalistische Bewegung gab es aber weiterhin Anlass für umfangreiches Engagement: 1973 fand der von den USA unterstützte Militärputsch Pinochets gegen die demokratisch gewählte Regierung des Sozialisten Allende in Chile statt; dass damit ein neuer, bald die globale Ordnung langfristig bestimmender Zyklus neoliberaler Wirtschaftspolitik eingeleitet wurde, war nur für wenige absehbar. Nahezu zeitgleich gab es breite internationale Unterstützung für den Sturz der Militärdiktaturen in Griechenland, Spanien und Portugal oder die Herrschaft des Schahs im Iran; während sich 1976 das Militär in Argentinien an die Regierung putschte und in Brasilien eine Militärdiktatur seit 1964 und bis 1985 fortbestand. Die Kämpfe der Befreiungsbewegungen in Nicaragua und El Salvador gegen die lokalen Oligarchien, die als Kompradorenbourgeoisien die Interessen ausländischer Regierungen und Unternehmen gegen die eigene Bevölkerung und nationale Kapitalfraktionen vertraten, die in hohem Maße korrupt, antidemokratisch und repressiv waren, wurden insbesondere in den 1980er Jahren durch breite internationalistische Kampagnen und Solidaritätsbewegungen unterstützt, aus denen heraus dann viele als BrigadistInnen in die entsprechenden Länder reisten. Diese Entwicklungen verliefen sowohl in der Ereignisfolge der sozialen Kämpfe als auch in der sozialstrukturellen Dynamik sehr ungleichzeitig.
Der Internationalismus war durch spezifische Erfahrungen und Widersprüche gekennzeichnet, von denen ich einige andeuten möchte. Erstens: Zunächst ist die Asymmetrie der Beziehung zu betonen, denn es ist ja an sich eigentümlich, dass Akteure eines reichen kapitalistischen Staates anderswo hingehen und sich mit dem Anspruch, zu zivilisieren, zu helfen, zu entwickeln, zu unterstützen, in das Leben anderer einmischen. Da das aber von herrschender Seite geschieht, liegt es nahe, dass die gesellschaftskritischen Kräfte ihrerseits etwas unternehmen, um die Menschen zu unterstützen, die von der Ausbeutung durch die Zentren betroffen sind. Dies bringt internationalistische Bemühungen durchaus in den Widerspruch, dass sie bevormundend wirken können.
Zweitens: Es handelte sich um Solidaritätsbeziehungen, die durch die Form des Nationalstaats geprägt waren. Die emanzipatorischen Akteure können selten direkt dauerhaft miteinander aktiv werden und als eine zusammenhängende Kraft wirken; sie werden vielmehr blockiert und vermittelt durch die imperialistischen und nationalstaatlichen Apparate: hier die reichen, imperialistischen Nationalstaaten, dort die Bewegungen, die darum kämpften, einen unabhängigen Staat zu bilden oder in den bestehenden Staaten die Macht von den Kolonialherren und ihren lokalen Vertretern zu übernehmen. Staaten wie die Sowjetunion oder Jugoslawien konnten – nach spezifischen eigenen Interessenkalkülen – militärische oder ökonomische Hilfe gewähren und entsprechend abhängig machen und in Loyalität zwingen. Die Linke in westlichen Staaten – in den meisten Fällen ohne Regierungsmacht – konnte diese oder jene Befreiungsbewegungen und ihre Mitglieder eher nur politisch und kulturell, weniger materiell, unterstützen.
Die Unterstützungspraktiken sind angesichts der Konstellation widersprüchlich. Gelegentlich handelt es sich um ein paternalistisches Pflichtverhältnis: linke Organisationen und Gewerkschaften schicken Delegationen in Länder und auf Konferenzen, die Grußworte sprechen; folkloristische Veranstaltungen oder Diskussionsabende werden organisiert, etwas Geld wird gesammelt. Solidarität kann auf falschen, romantisierenden Annahmen über Lebensformen der unterstützten Bevölkerung oder auf dem Wunsch nach «Revolutionstourismus» beruhen. Kritische Solidarität ist weder bei denen erwünscht, die die Solidarität erfahren, noch bei Teilen der Solidaritätsbewegung, die Kritik am Umgang mit Minderheiten oder dissidenten Gruppen, an Menschenrechtsverletzungen, an Extraktivismus, an falschen wirtschaftspolitischen Strategien nicht hören wollen, weil sie befürchten, die Solidarität könnte geschwächt oder Machtinteressen verletzt werden.
Drittens: Die Unterstützungsbereitschaft und das Engagement folgen einem bestimmten Aufmerksamkeitsmuster und können kurzzeitig zu riesigen Mobilisierungen in den Zentren führen und zum Erfolg der Befreiungsbewegungen beitragen. Denn die Unternehmen, der Regierungsapparat, die Geheimdienste, die herrschende Öffentlichkeit werden nun daran gehindert, die lokalen herrschenden Gruppen weiterhin offen zu unterstützen und die Freiheits- und Emanzipationsbestrebungen zu bestreiten oder zu denunzieren. Doch kann das Engagement schnell versiegen oder sich auf andere Regionen oder Konflikte verlagern. Für die internationalistische Solidarität ist es schwierig, ein dauerhaftes Engagement herzustellen und aufrecht zu erhalten.
Viertens: Es ist bemerkenswert, dass diejenigen, die sich so umfassend engagierten, sich vor allem nur für die Aufstiegs- und Kampfphase einer Befreiungsbewegung interessierten, nicht jedoch für das, was nach der Übernahme der Regierungsmacht geschieht. Offensichtlich gibt es eine große Bereitschaft, das Ziel nationaler Selbstbestimmung zu fördern. Jedoch müsste die Frage gestellt werden, ob die Ziele der Emanzipation weiterverfolgt und in welche Maße sie erreicht werden.
In Angola kam mit der MPLA eine kleptokratische Familie an die Macht; Eritrea wurde zu einer Militärdiktatur; in Südafrika entstanden aus dem ANC heraus korrupte Machtcliquen; in Nicaragua spalteten sich die Sandinisten angesichts der Korruption und autoritären Machterhaltungspraktiken der eigenen Regierung. In Kuba werden Kritiker mundtot gemacht oder verfolgt. China und Vietnam fügen sich erfolgreich in die kapitalistische Arbeitsteilung ein. Obwohl sich beide Staaten als kommunistisch bezeichnen, wird der diktatorische Charakter in den Mainstreammedien nur in den seltenen Fällen einer Krise erwähnt, in der Linken wird der autoritäre Charakter eher verhalten thematisiert.
Dabei ginge es nicht nur um die demokratische Verfassung oder die Menschenrechte: also Bewegungs-, Meinungs- oder Wissenschaftsfreiheit oder die Freiheit von Minderheiten, sondern auch um die Emanzipation der ArbeiterInnen vom Schicksal der Lohnarbeit. Die Verfolgung vieler Vietnamesen nach dem gewonnen Befreiungskrieg, die Politik des Roten Khmer in Kambodscha waren ein Schock, der viele in der europäischen Linken mit Sozialismus oder Kommunismus hat brechen lassen. Er hat nicht dazu geführt, dass sich die Solidaritätsbewegungen genauer ansehen, wen sie unterstützen, für welche gesellschaftliche Entwicklungstendenz eine Gruppe steht, welche Kräfte in der Gesellschaft wirken und vor allem: welche Politiken eine erfolgreiche Gruppe verfolgt und wie vielleicht auch im Weiteren auf sie eingewirkt werden kann. Das Solidaritätsprinzip kann in Ignoranz und Schweigen oder in Distanz, Desinteresse und Entsolidarisierung übergehen.
Fünftens: Offensichtlich gibt es eine Fixierung des Internationalismus auf die Selbstbestimmung des Staates. Denn die internen Differenzen einer Gesellschaft – also der Schutz von besonderen Bevölkerungsgruppen mit eigenen kulturellen Traditionen, Religion, Sprache – hat nur in Maßen zu internationalistischer Unterstützung beigetragen: der Fall von indigenen Gesellschaften in den Amerikas, die Tibeter oder die Uiguren, die Menschen in den riesigen Flüchtlingslagern, die über Jahrzehnte bestehen; die Gewalterfahrung von Frauen oder sexuellen Minderheiten; die Kämpfe lokaler ArbeiterInnen; die Aktivitäten gegen große Bau- und Entwicklungsprojekte. Es ist keine Frage, es hat sich in diesen Hinsichten seit den 1970er und 1980er Jahren Manches zum Positiven verändert.
Die Dekolonialisierung seit den frühen 1920er und dann seit den 1940er Jahren ergab für die früheren Imperialstaaten eine historisch neuartige Situation. Die kapitalistische Gesellschaft hat sich seit 1500 allmählich ausgedehnt und durch die Aneignung von Kolonien, Rohstoffen, Nahrungsmitteln und Sklavenarbeit erweitert reproduziert. Dies prägte auch die Herrschaftsverhältnisse in den Zentren. Diese waren großräumige Imperien, überschüssige Bevölkerungsanteile konnten in die Kolonien geschickt, ein enormer Reichtum konnte abgeschöpft, ein Teil davon an besondere Kategorien der ArbeiterInnenklasse transferiert werden.
Nun mussten sie sich in Nationalstaaten transformieren, die mit einer Vielzahl von neuen Nationalstaaten zu tun hatten, die ihrerseits nationale Souveränitätsrechte hatten und formell unabhängig waren. Die imperialistischen Zentren schrumpften, sie mussten eine neue internationale Arbeitsteilung entwickeln, intern mit ihren Widersprüchen umgehen, und sie wurden nun ihrerseits zum Ziel von Migration. Herrschafts- und Ausbeutungsbeziehungen, sollten sie nicht zusammenbrechen, mussten seit den 1970er und 1980er Jahren reorganisiert werden. Die neuen Staaten wurden schuldenabhängig gemacht, ihre Wirtschaftsstruktur wurde in die internationale Arbeitsteilung so eingebunden, dass sie vor allem mit Rohstoffen und billiger Arbeitskraft dienten. Entsprechend prägten Agrobusiness, Extraktivismus, die mangelnde Verfügung über Patente und isolierte Industrien die abhängigen Staaten. Die Gewinne wurden von korrupten lokalen Machtgruppen angeeignet und verbreitet für Luxuskonsum und Rüstung verwendet.
Mit dem Zusammenbruch des Staatssozialismus und der Öffnung Chinas seit den 1970er Jahren bot sich eine Lösung der Krise an: Es entstanden neue Märkte. Vor allem konnte Kapital exportiert werden, um marktnah zu produzieren, um schon abgeschriebene Maschinen weiter zu nutzen, um niedrige Herstellungskosten (unter Umgehung sozialer, rechtlicher oder ökologischer Standards) zu nutzen und auf die billigen Arbeitskräfte zuzugreifen. Die neoliberale Globalisierung setzte unter der Führung der USA – der einzigen verbliebenen Supermacht – den Sachzwang Weltmarkt durch. Globalisierte Unternehmen strukturierten weltweit verflochtene Produktions- und Konsumketten. Die Nationalstaaten verfolgten eine Politik der Privatisierung und Deregulierung. Die Gewerkschaften wurden dadurch erheblich geschwächt, was auch negative Auswirkungen auf ihren Internationalismus hatte. Linke Parteien gerieten durch diese Entwicklung in eine Krise, da die Politikkonzepte der fordistischen Phase nicht mehr griffen.
Der sogenannte Globalisierungsprozess beruht auf einer neuen internationalen Arbeitsteilung, die Wertschöpfungsketten werden zergliedert und flexibel über viele Regionen der Erde verteilt, die in souveräne Nationalstaaten gegliedert sind. Damit ändert sich auch das Verständnis von Internationalismus, denn es geht nicht mehr um ein hierarchisches und asymmetrisches Verhältnis der internationalistischen Solidarität des Nordens mit dem Süden, der Zentren mit der Peripherie, der reichen mit armen Staaten.
In allen Weltregionen bilden sich reiche Zentren mit Superreichen ebenso wie arme Peripherien mit hohen Arbeitslosenzahlen und Armen. Es kommt zu enormen sozial-räumlichen Ungleichzeitigkeiten; doch gleichzeitig formiert sich auch etwas wie eine gemeinsame globale Sicht, ein Verständnis von Problemen, die die Menschheit als Ganze betreffen und ein gemeinsames Handeln erforderlich machen. Ziele, Akteure, Themen, Praktiken des Internationalismus ändern sich.
Dies wird in Ansätzen erfahrbar in der Folge der großen UN-Konferenzen (Weltumweltkonferenz, Weltfrauenkonferenz, Klimakonferenzen), an zivilgesellschaftlichen Aktivitäten von PolitikerInnen und UnternehmerInnen in halbprivaten Gremien wie Trilaterale Kommission oder Weltwirtschaftsforum. Damit einher gingen neue Auffassungen von Regierung als nicht-förmliches Regieren im Schatten des Staates. Verbunden ist damit ein Prozess der Bildung und öffentlichen Förderung von Nichtregierungsorganisationen. Sie engagieren sich im Prinzip in jedem Lebensbereich: Gewerkschaftsrechte, Ökologie, Klima und Artenvielfalt, ArbeiterInnen und KonsumentInnen und ihre Bedrohung durch Produkte oder Produktionsverfahren, Menschenrechte, Rüstung, Migration, medizinische Versorgung, Wasser und Ernährung, Landwirtschaft, Stadtentwicklung und Landschaftszerstörung, Korruption, Großbauprojekte, Geschlecht und Sexualität. Auch wenn vielfach die NGOs aus dem Norden finanziert werden und mit staatlichen verbunden sind, hat ihre Arbeit doch Rückwirkungen auf die kapitalistischen Zentren selbst, die sich gefallen lassen müssen, dass die Maßstäbe, Kritiken und Veränderungen rückwirkend auch auf die Zentren Anwendung finden.
Gegen die Globalisierung und gegen das Einheitsdenken des Washington Consensus stellten die Kämpfe der Zapatisten in Chiapas (1994) ein Aufbruchssignal für die sozialen Bewegungen dar. Mit den Wahlerfolgen von Hugo Chavez (1999), Evo Morales (2005), Rafael Correa (2007) begannen alsbald die Versuche eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts – die einen gewissen Rückhalt in den Wahlerfolgen von Lula in Brasilien (2002 und 2006), den beiden Kirchners in Argentinien (ab 2003) oder Mujica (2009) in Uruguay fanden.
Diese Projekte stellten sich ausdrücklich gegen eine mehrhundertjährige koloniale Unterdrückung und Ausbeutung ihrer Länder. Die Zapatisten organisierten eine neue Form der Gemeindedemokratie, in Venezuela wurde mit Räten experimentiert, Bolivien gab sich eine neue, plurinationale Verfassung, die die Rechte der indigenen Gemeinden stärkte und berücksichtigte, ähnlich wie die anderen beiden Regierungen verfolgte Correa eine Politik gegen die internationalen Institutionen und Unternehmen, gegen eine von den USA bestimmte Freihandelspolitik, er trat für eine bolivarianische Veränderung Lateinamerikas ein und verfolgte eine Politik der Armutsbekämpfung.
Auch wenn diese Bemühungen sehr schnell auf große Widerstände stießen, wurde in Bolivien und Ecuador das Ziel verfolgt, den Extraktivismus zu vermeiden und eine langfristige Politik konzipiert, durch die die Nutzung der Rohstoffe den inneren Entwicklungen der Länder und dem buon vivir der lokalen Bevölkerungen dienen sollte. Diese Länder handelten teilweise selbst internationalistisch. Die Weltsozialforumsbewegung (Porto Alegre 2001) wurde geschaffen, die auch eine Süd-Süd-Solidarität ermöglichte, durch die sich AktivistInnen vernetzen und gemeinsame Aktionen organisieren konnten.
Im globalen Norden gab es umfangreiche Widerstände und Proteste gegen die Entscheidungen der Regierungen, eine Politik der neoliberalen Globalisierung zu verfolgen (in Seattle 1999 gegen das Treffen der WTO; G8-Treffen in Genua 2001; EU-Gipfel in Göteburg 2001; G8-Treffen in Heiligendamm 2007). Bei all diesen fanden Bewegungsorganisationen wie Attac, linke, kirchliche, Dritte-Welt-Gruppen zusammen, die für eine andere Weltordnung eintraten.
Die Entwicklung nach der Weltwirtschaftskrise 2007/2008 hat zur Bildung und Entfaltung sozialer Bewegungen beigetragen, die seit 2011 in schnell aufeinander folgenden Wellen stattfanden, gleichzeitig zahlreiche Länder ergriffen und viele Sektoren der Gesellschaften erfassten und mobilisierten (Tahir, Puerta del Sol, OWS, Blockupy).
Hier stellt sich der Internationalismus erneut nicht als eine asymmetrische Beziehung dar, sondern als ein (keineswegs immer einfacher) Austausch der Erfahrungen, der Übernahme von Strategien und Zielen, der Absprachen zu gemeinsamen Aktivitäten. Für die internationalistischen Akteure in den Ländern des Nordens bedeutet dies in hohem Maße auch eine Rückwendung auf die eigenen Verhältnisse und die Übernahme einer neuen Form von Verantwortung. Denn angesichts des sich beschleunigenden Klimawandels, des Artensterbens, der Zerstörung von Lebensgrundlagen insbesondere in den Regionen des globalen Südens geht es darum, die Lebensweise in den kapitalistischen Zentren auf nachhaltige, suffiziente, friedliche Produktions- und Konsummuster umzustellen.
Erst eine solche Transformation würde es auch den Gesellschaften der Peripherie oder des globalen Südens erlauben, sich von den vielfältigen imperialen Abhängigkeitsbeziehungen emanzipieren zu können. Gleichzeitig entsteht daraus jedoch eine neue, gemeinsame Verantwortung. Denn die Transformation kann nicht Abschottung und Autarkie der kapitalistischen Zentren bedeuten; dies würde viele Regionen der Erde in noch schlimmere Situationen stürzen. Es bedarf freier und selbstbestimmter Formen der Kooperation, des Wissenstransfers, der gemeinsam koordinierten Produktion. Die reichen Länder müssen somit die ärmeren Gesellschaften darin unterstützen, ihre eigenen Lebensverhältnisse auf der Höhe der Weltvergesellschaftung zu transformieren.
Dies muss im Bewusstsein geschehen, Gewalt und Paternalismus zu vermeiden. Die kapitalistischen Zentren müssen bei sich anfangen, den Zwang zur immer weiteren Akkumulation beseitigen – was durch autoritär-populistische Politiken, die den Fossilismus, die Aufrüstung, die Inwertsetzung von Rohstoffen und Arbeit voranzutreiben versuchen, auf erhebliche Widerstände stößt – und gleichzeitig dazu beitragen, dass die Gesellschaften des Südens sich auf endogene Weise entwickeln können. Gemeinsam müssen alle herausfinden, welche Verhältnisse ihnen ein gemeinsames Leben ermöglichen.
Internationalismus bedeutet in diesem Sinn eine Solidarität mit den Fernsten, die nun, und nicht nur als Geflüchtete, ganz nahe gerückt sind – weil sie unmittelbar die Arbeit, die Nahrungsmittel, die Luft und das Wasser teilen. Es geht darum, einen gemeinsamen Prozess des Übergangs zu organisieren, in dem die reichen Zentren, wo immer sie sich befinden, nicht mehr reich bleiben dürfen, in dem sie auf Ressourcen verzichten oder sie teilen, sich auf eine von allen bestimmte getragene Naturaneignung und Arbeitsteilung einlassen und an Transformationskonzepten mitarbeiten, die zu einer Menschheit führt, die sich mit sich und der Natur versöhnt. Es bedürfte – wie Jacques Derrida vor zwei Jahrzehnten in die Diskussion eingebracht hat – einer ganz neuen Internationale.