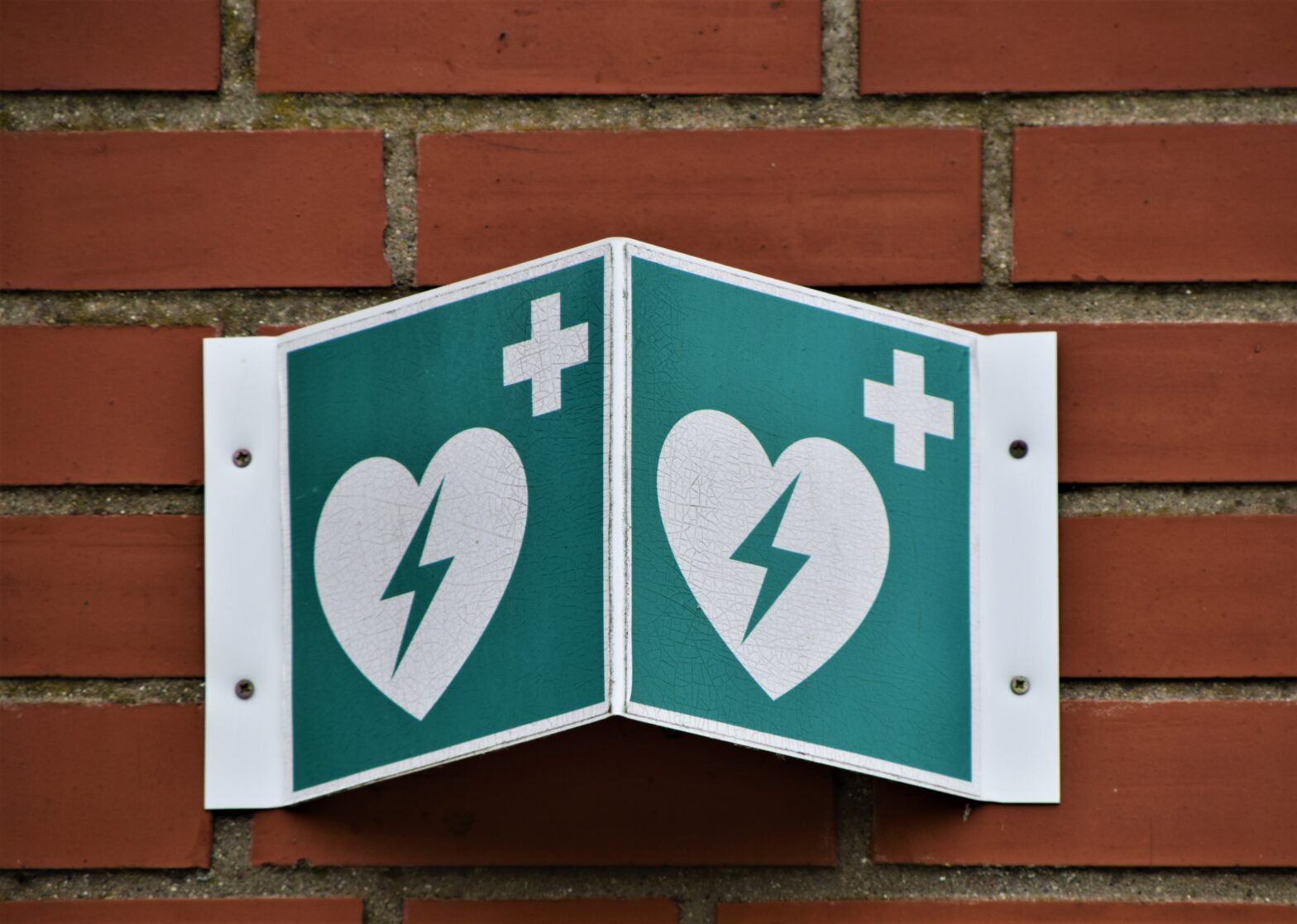Aktie Twitter Facebook Email Copy URL
Eva Wuchold und Jan van Aken über die soziale Dimension von Gesundheit und Krankheit
Warum ist dieser Zusammenhang zwischen Gesundheit und Lebensbedingungen aus dem Fokus geraten, nachdem er im vergangenen Jahrhundert doch einmal gut präsent war in den sozialen Kämpfen?
Van Aken: Vor allem auch aus Epidemien hat man schon im 19. Jahrhundert gelernt, dass Armut sehr viel mit Krankheit einhergeht und zu tun hat. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, als auch das Private politisch gesehen wurde, da wurde auch Gesundheit politischer betrachtet. In Deutschland findet bis heute jährlich der Kongress „Armut und Gesundheit“ statt. Die große Frage ist: Warum ist das Thema in der Breite der Bevölkerung nicht im Bewusstsein? Ich glaube, das hat mit Kapitalismus zu tun. Was im Vordergrund steht, sind neue Produkte und Dienstleistungen, die sich zu Geld machen lassen. Das ist für uns der Inbegriff von Gesundheit. Darin hat Armut keinen Platz.
Es war interessant, zu sehen: Als während der Covid-19-Pandemie in New York klar wurde, dass in den armen Stadtteilen die Sterberaten viel höher sind, hat es doch eine ganze Weile gedauert, bis da ein Zusammenhang hergestellt wurde. Schlechtere Wohnverhältnisse, Arbeitsbedingungen, mehr Armut – zu Beginn hat man trotzdem erst einmal geglaubt, hier könne es sich um eine genetische Disposition handeln. Soziale Bedingungen wurden von vielen Wissenschaftler*innen schlicht ausgeblendet. Das ist verrückt.
Wuchold: In Ländern aller Einkommensniveaus folgen Gesundheit und Krankheit einem sozialen Gradienten: je niedriger die sozioökonomische Position, desto schlechter die Gesundheit. Die Lösung des Problems liegt demnach auf der Hand: Abbau von materiellen und sozialen Ungleichheiten zur Beseitigung gesundheitlicher Ungleichheiten. Dass dies in den letzten Jahrzehnten aus dem Blickfeld der sozialen Bewegungen verschwunden ist, hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Gesundheitssysteme im globalen Vergleich sehr unterschiedlich aufgestellt sind und sich auch die jeweiligen Kämpfe dementsprechend stark unterscheiden. In manchen Regionen geht es um den Aufbau von Basisgesundheitsversorgungssystemen, in anderen um die Einführung gesetzlicher Krankenversicherungen, in wieder anderen um die Privatisierung öffentlicher Gesundheitseinrichtungen.

Die neoliberale Auslegung macht es sich einfach: Der Mensch ist frei. Demzufolge ist er auch verantwortlich dafür, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Spricht man jedoch von der sozialen Dimension von Gesundheit, muss man von gesellschaftlicher Verantwortung reden. Worin besteht die?
Van Aken: Darin, zuerst einmal die Frage zu stellen, woher Krankheit kommt: Übergewichtigkeit zum Beispiel hat mit schlechter Ernährung zu tun. Es wäre also ein richtiger Weg, zum Beispiel bestimmte Nahrungsmittel zu verbieten, die krank machen. Oder zumindest Obergrenzen für Zucker, Fett und andere Gifte. Eine sozial sinnvolle Gesundheitspolitik würde also stets nach Ursachen von Krankheit fragen. Und die Ursachen, die sich ausräumen lassen, auch beseitigen. Das ist aber kaum möglich heute, widerspricht es doch völlig den Interessen des kapitalistischen Systems.
Wuchold: Genau daran krankt das Gesundheitssystem: Schritt für Schritt wurde es in den letzten Jahrzehnten aus einer am Gemeinwohl orientierten Wirtschaft herausgelöst und dem Konkurrenzprinzip des Kapitalismus unterworfen. Seit dem Ende des Wachstums in den 1970er Jahren beruht die Verwertung des Kapitals zunehmend auf Prozessen der Enteignung von Gemeingütern. Was die Weltbank und der Internationale Währungsfonds den Ländern des Südens verordneten, nämlich den Abbau der sozialen Infrastruktur, forderten Unternehmensberater in ähnlicher Weise zunehmend von den Gesundheitseinrichtungen in den Ländern des Nordens. Den Diskurs um „öffentliche Gesundheitsversorgung“ haben vor der Corona-Pandemie nur noch wenige geführt. Stattdessen galt Gesundheit als Wachstumsmarkt. Es ging darum, wie die Anleger, und nicht darum, wie die Patient*innen profitieren. Dienstleister aller Art, vor allem aber die Pharmaindustrie, haben in den letzten Jahrzehnten darauf gedrängt, die soziale Dimension der Gesundheitspolitik auszublenden und sich auf das Management von Krankheiten zu konzentrieren.
Hat da auch die gesellschaftliche Linke zu wenig gegengehalten?
Wuchold: Es ging zwar immer wieder einmal um den Zugang zu bestimmten Medikamenten oder um die Produktion von Generika, aber nicht um das System als Ganzes. Problembereiche wurden allenfalls punktuell angegangen, zum Beispiel die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte, nicht aber kontinuierlich.
Van Aken: Es gibt ja zu vielen Gesundheitsthemen Menschen, die in Bewegung sind. Etwa was den Zugang zu Medikamenten betrifft, denken wir an die Aids-Kampagne in den 1980er Jahren. Aber warum gibt es keine breitere Bewegung? Darüber haben wir viele Gespräche geführt und häufig die Antwort gehört: Im Gesundheitsbereich entsteht Bewegung vor allem dann, wenn Menschen direkt betroffen sind. Wenn dann die Kampagne gewonnen und das Problem gelöst ist, sind die Bewegungen auch wieder weg. Da ist Aids ein gutes Beispiel. Die meisten, mit denen wir gesprochen haben, glauben nicht, dass es eine breite soziale, sich verstetigende Gesundheitsbewegung geben wird. Stattdessen werde das aufgegriffen, wenn es sich an andere Themen andocke. Das spürt man bei der Klimabewegung sehr stark. Dass der Klimawandel krank macht, ist ein Thema. Aber es läuft sozusagen mit.
Ihr macht explizit einen Zusammenhang auf zwischen Demokratisierung und der Schaffung von Entscheidungsstrukturen der globalen Gesundheitspolitik jenseits der Privatwirtschaft. Was hat Demokratie mit Gesundheit zu tun?
Wuchold: Gesundheit ist ein Menschenrecht. Um verwirklicht zu werden, muss es in der Ausrichtung der Gesundheitspolitik das zentrale Anliegen sein, und nicht die hohe Bettenauslastung, das Einhalten von Praxisbudgets oder Pharma-Renditen. Dies bedarf sowohl einer Beteiligung von Patient*innen und Mitarbeiter*innen an institutionellen Entscheidungen als auch einer Stärkung ihrer Rechte insgesamt.
Van Aken: Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Weltgesundheitsorganisation WHO die erste Unterorganisation der UNO, die gegründet wurde. Weil Gesundheit als gemeinschaftsstiftendes Element gesehen wurde, und es gibt viele Beispiele dafür, dass der Aufbau von Gesundheitssystemen in Post-Konflikt-Situationen ein guter Weg war, Menschen wieder zusammenzubringen. In Kuba gibt es trotz geringer Mittel und demokratischer Defizite ein gutes Gesundheitssystem, das in der Breite funktioniert. Es braucht den politischen Willen, da viele staatliche Ressourcen reinzustecken, dann bildet sich darüber auch ein gesellschaftlicher Zusammenhang.
Was genau muss demokratisiert werden, um der zunehmenden Einhegung eines Menschenrechts durch Markt und Kapital etwas entgegenzusetzen?
Wuchold: Es müsste ein von den Mitarbeiterinnen im Gesundheitsbereich und den Patientinnen kontrolliertes System aufgebaut werden, das mit entsprechenden materiellen und personellen Ressourcen ausgestattet und resistent gegen Pandemien ist. „Demokratisch“ hieße auch, dass es eine einheitliche soziale Krankenkasse gibt, finanziert durch Einkommens-, Vermögens- und Unternehmenssteuern. Alle, auch Geflüchtete, Obdachlose und Sans-Papiers, müssten versichert sein. Maßnahmen zur Markt- und Wettbewerbsorientierung (unter anderem Fallpauschalen) müssten ebenso wie Privatisierungen entschädigungslos rückgängig gemacht werden. Gesundheit wäre nicht länger eine Ware. Dazu müssten auch Pharma- und Diagnostikindustrie unter öffentliche Kontrolle gestellt werden. Demokratisierung hieße auch, durch Steuern und Ähnliches eine umfassende Gesundheits- und Sozialversorgung im globalen Maßstab zu schaffen.
Was bedeutet das für bestehende globale Strukturen der öffentlichen Gesundheit wie die WHO, muss sie erneuert oder gar ersetzt werden?
Wuchold: Der Gründungsauftrag der WHO lautet, zur Erreichung des höchsten Gesundheitsniveaus für alle Menschen beizutragen. Bereits in der Deklaration von Alma-Ata (Kasachstan), dem Abschlussdokument der Konferenz von 1978, forderte sie ein globales System der primären Gesundheitsversorgung. Damit sie diese Aufgabe erfüllen kann, muss sie zu den in ihrer Verfassung beschriebenen Organisationszielen zurückkehren: auf der Grundlage fundierter und unabhängiger wissenschaftlicher Erkenntnisse zu einer allgemeinen Verbesserung der Lebensbedingungen beizutragen. Dies erfordert jedoch ein Umdenken bei der Mehrheit der Mitgliedsstaaten. Stagnation und Kürzungen bei den Pflichtbeiträgen an die WHO trugen ebenfalls zu ihrer Schwächung bei, da immer mehr gesundheitsrelevante Aktivitäten zu anderen Institutionen abwanderten, zunächst zu anderen UN-Organisationen, später aber auch zu öffentlich-privaten Partnerschaften, wie dem Globalen Fonds oder der Globalen Allianz für Impfstoffe Gavi, und zuletzt zu Multistakeholder-Initiativen.
Van Aken: Das bedeutet, alle Stakeholder (Interessengruppen), auch die Industrie, sitzen direkt mit am Tisch, wenn Entscheidungen getroffen werden. Dazu kommen nichtdemokratische Gremien, wie G7, G20, wo Entscheidungen an der Weltgemeinschaft vorbei getroffen werden. Eben nicht mit allen 194 Mitgliedsländern der WHO. Die wichtigsten Entscheidungen fallen inzwischen nicht mehr in der WHO, sondern in undemokratischen Strukturen. Das ist falsch.
Es ist ein hoffnungsvolles Zeichen, wenn sich eine Stiftung, wie die RLS, des Themas annimmt. Womit soll angefangen werden?
Van Aken: In Deutschland hat die Stiftung schon viele Jahre sehr intensiv an dem Thema Gesundheit gearbeitet: Rekommunalisierung von Krankenhäusern, gute Bezahlung in der Pflege, um nur zwei Bereiche zu nennen. Sie weiß, dass soziale Fragen und Gesundheitsfragen nicht zu trennen sind. Globale soziale Gerechtigkeit ist das Leitthema in der weltweiten Arbeit. Jedes Büro der Stiftung setzt sich das als Überschrift. Und Gesundheit gehört zu sozialer Gerechtigkeit.
Wuchold: Mit der Diskussion um Globale Soziale Rechte wurde bereits vor einigen Jahren ein Prozess dafür eingeleitet, gemeinsame Themen und zum Teil auch Projekte zu finden. Dies war zunächst das Klimathema, später auch das Agrarthema. Dass jetzt Gesundheit eine zentralere Rolle spielen wird, ist sehr zu begrüßen, denn: Wer über Gesundheit reden will, kann über soziale Gerechtigkeit, über globale Gerechtigkeit, aber auch über die Auswirkungen des Klimawandels und vieles mehr nicht schweigen.
Eva Wuchold leitet das Programm Soziale Rechte der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Büro Genf. Jan van Aken arbeitet für das dortige Programm zum Thema Global Health. Das Gespräch führte Kathrin Gerlof.