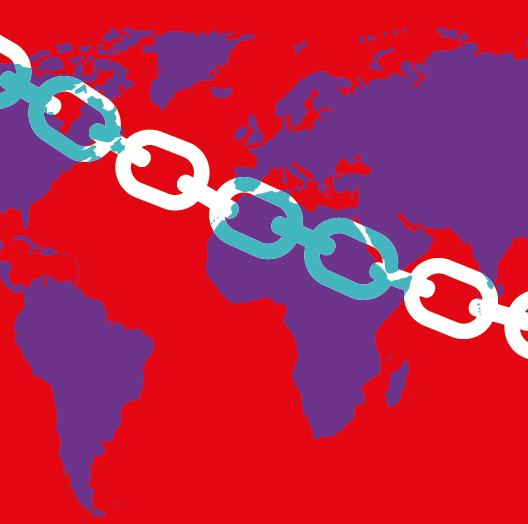Aktie Twitter Facebook Email Copy URL
In den Vereinigten Staaten bilden der Ort der Geburt und die Abstammung einer Person zwei mächtige Mythen, die die Zugehörigkeit zur Nation begründen. Für Eingewanderte hingegen steckt das US-Staatsangehörigkeitsrecht voller Ungerechtigkeiten und Gefahren

Stephanie DeGooyer ist Assistenzprofessorin an der University of North Carolina at Chapel Hill. Sie befasst sich vor allem mit transatlantischer Literatur, Recht und politischer Philosophie, besonders im Hinblick auf Staatsbürgerschaft und Immigration. Der Text erschien am 18. Juli 2019 unter dem Titel „Rethinking Birthright“ auf der Website Boston Review. Die Autorin hat ihn für diese Veröffentlichung bearbeitet.
Der Text erschien im Reader zum Atlas der Staatenlosen in den Sprachen deutsch, englisch und französisch.
Archie Harrison Mountbatten-Windsor wurde am 6. Mai 2019 in einem Londoner Privatkrankenhaus als Sohn einer amerikanischen Mutter (Meghan Markle) und eines englischen Vaters (Prinz Harry) geboren. Archie kam als Siebter in der englischen Thronfolge auf die Welt, aber als erstes Mitglied der königlichen Familie, das sowohl Bürger Großbritanniens als auch der Vereinigten Staaten ist.
Entscheidend dabei ist, dass Archie bei seiner Geburt nicht nur einfach US-Staatsbürger wurde, sondern dass er als ein „natural born citizen“ gilt, also als gebürtiger US-Bürger. Dieser Status wurde erstmals in Artikel II, Abschnitt 1 der US-Verfassung erwähnt, in dem es heißt: „In das Amt des Präsidenten können nur in den Vereinigten Staaten geborene Bürger oder Personen, die zur Zeit der Annahme dieser Verfassung Bürger der Vereinigten Staaten waren, gewählt werden.“
Der kleine Archie könnte also das werden, was die US-amerikanischen Gründerväter am stärksten fürchteten: ihr Präsident, und das als englischer Prinz. Allerdings war die „Natural born”-Klausel in der Verfas-sung in den vergangenen Jahren mehrfach Gegenstand besorgter Debatten. So stritten Ted Cruz und Donald Trump im Jahr 2016 während der Präsidentschaftsnomi-nierung der Republikanischen Partei darüber, ob sich der im kanadischen Calgary als Sohn einer US-amerikanischen Mutter und eines kubanischen Vaters geborene Cruz überhaupt für das Präsidentenamt qualifiziere.
Nach Trumps Auffassung bezogen sich die Väter der Verfassung mit ihrer Vorgabe, der Präsident müsse ein gebürtiger US-Bürger sein, auf das Prinzip des Jus soli („Recht des Bodens“). Cruz‘ Antwort darauf lautete, er sei ein gebürtiger US-Bürger gemäß einem anderen Nationalitätsprinzip, nämlich dem Jus sanguinis („Recht des Blutes“), das die Staatsbürgerschaft von einer bio-logischen Verbindung zu einem US-amerikanischen Bürger abhängig macht.
Die meisten Verfassungsrechtler stimmen mit Cruz‘ Interpretation überein. Auch wenn sich der Status als gebürtige*r US-Bürger*in zunächst einmal auf den Geburtsort zu beziehen scheint, so nennt der Wissenschaftliche Dienst des US-Kongresses in einem Bericht von 2011 doch drei Möglichkeiten, wie Individuen zu diesem Status kommen: „… entweder indem sie ‚in‘ den Vereinigten Staaten und unter deren Gerichtsbarkeit geboren werden, auch wenn sie von ausländischen Eltern abstammen, oder indem sie im Ausland als Kinder von US-Bürgern geboren werden oder indem sie unter anderen Bedingungen geboren werden, die die gesetzlichen Anforderungen für die US-Staatsbürgerschaft ‚ab Geburt‘ erfüllen.“ Um als gebürtige*r US-Bürger*in zu gelten, muss eine Person demnach eine biologische Bindung zu den USA haben, sei es durch den Geburtsort oder durch ein Elternteil.
Dieser Status ist nicht nur für die wenigen Menschen von Bedeutung, die sich alle vier Jahre um das Präsidentenamt bewerben, sondern auch für die gesamte US-amerikanische Bevölkerung. Sie wird in zwei Grup-pen unterteilt: Bürger*innen, für die die Staatsbürger-schaft ein Geburtsrecht ist, und Eingebürgerte, die sie als eine Art Gabe erhalten. Diese Unterscheidung wurde erst vor Kurzem spürbar, als Trump twitterte, dass vier dunkelhäutige Kongressabgeordnete dorthin „zurückgehen“ sollten, wo sie herkämen.
Archie ist das erste Mitglied der königlichen Familie, das sowohl Bürger Großbritanniens als auch der Vereinigten Staaten ist.
In den meisten Nachrichten wurde eiligst darauf hingewiesen, dass drei der vier Frauen doch in den USA geboren seien. Anders die vierte betroffene Abgeordnete, die gebürtige Somalierin Ilhan Omar: In der Wahrnehmung der USA unterscheidet sie sich nicht nur von den anderen dreien, weil sie die Staatsbürgerschaft erst beantragen musste, sondern weil die biologischen Definitionen, an die die Staatsangehörigkeit geknüpft wird, sie zu einer nicht zugehörigen Bürgerin machen.Nehmen wir den Fall eines anderen Kindes, das im selben Jahr wie Archie in London von einer Leihmutter als Kind eines gleichgeschlechtlichen männlichen Paa-res geboren wurde. Die Eltern des Babys sind verheiratet, und beide sind US-Bürger, obwohl ein Elternteil – und zwar der, der das Sperma gespendet hatte – in Großbritannien geboren wurde. Kurz nach der Geburt wurde das Paar durch ein Schreiben des US-Außenministeriums davon in Kenntnis gesetzt, dass ihr Kind nicht qua Geburt US-Staatsbürger sei. Der Elternteil mit der genetischen Verbindung zum Kind habe nicht das laut Gesetz erforderliche Minimum von fünf Jahren als US-Bürger in den Vereinigten Staaten gelebt, um seine Staatsbürgerschaft weiterzugeben. Der andere Elternteil, per Geburt US-Bürger, könne keine „Blutsverwandtschaft“ zu dem Kind nachweisen. Somit ist das Kind sowohl nach den Prinzipien des Jus soli als auch des Jus sanguinis in den USA ein Ausländer.
Wieso hat das Kind einer britischen Prinzessin, die vielleicht nie mehr in den USA leben wird, ein Recht auf die US-Staatsbürgerschaft, während das Kind zweier US-Bürger ein Touristenvisum beantragen muss, um seine Eltern in den USA zu besuchen? Wie kann es sein, dass Menschenmengen an eine US-Kongressabgeordnete gerichtet „Schickt sie zurück!“ grölen? Mit welcher moralischen oder historischen Begründung wird die Geburt als aussagekräftigeres Kriterium für staatsbürgerliche Treue angesehen?
1790 war die Staatsbürgerschaft auf Einwanderer beschränkt, die freie weiße Personen mit „gutem Charakter“ waren.
Diese Fragen erscheinen umso wichtiger, seit Trump in einem Fernsehinterview eine Rechtsverordnung zur Abschaffung der Staatsbürgerschaft nach dem Territorialprinzip ankündigte. „Wir sind das einzige Land auf der Welt“, behauptete er, „in dem jemand einreist und ein Baby kriegt, und das Baby wird tatsächlich ein Bür-ger der Vereinigten Staaten mit all den damit einhergehenden Vorteilen.“ (Dies ist natürlich nicht korrekt: In mehr als dreißig anderen Ländern gilt ebenfalls das Territorialprinzip). Trump will die Staatsangehörigkeit qua Geburtsort aus demselben Grund abschaffen, aus dem er eine Mauer bauen und Familien an der Grenze trennen will: um die „Invasion“ der Migrant*innen an der Südgrenze zu stoppen – und auf diese Weise für die nächsten Wahlen seine Anhänger zu mobilisieren. Wie häufig betont wird, wurde das geltende Staatsbürgerschaftsrecht eingeführt, um besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen in den USA zu schützen, namentlich die befreiten Sklav*innen. Heute schützt dasselbe Gesetz die Kinder von Eingewanderten ohne Aufent-haltsgenehmigung in den USA.
Doch das Territorialprinzip bietet zwar den in den USA geborenen Kindern von Eingewanderten Schutz, aber dieses Staatsbürgerschaftsrecht trägt nichts zum Schutz der Eltern dieser Kinder bei oder ihrer Geschwister, die als kleine Kinder in die USA kamen. In dieser Hinsicht ist das Jus soli allenfalls eine Verlegenheitslösung, die nur einigen Menschen hilft, während aber ebendieses Prinzip für viele andere eine Quelle der Ungleichheit darstellt. Ein faireres Staatsbürgerschaftsrecht würde voraussetzen, dass das Gesetz nicht länger zwischen Bürger*innen und Eingebürgerten unterscheidet. Das bedeutet nicht, dass in den USA Geborene künftig nicht mehr automatisch deren Staatsbürgerschaft erhalten sollen. Vielmehr wird auf diese Weise verhindert, dass ein so zufälliger Faktor wie der Geburtsort Schutz und Vorteile mit sich bringt, die später Eingebürgerten nicht zur Verfügung stehen.
Die Staatsbürgerschaft ist an sich schon eine Form der Spaltung und Ungleichheit. Grenzen sind insofern eine wesentliche Ursache von Ungleichheit, als sie soziale Vorteile für diejenigen vorsehen, die als „Insider“ gelten. Viele Linke fordern daher eine Öffnung der Grenzen – ein Vorschlag, der auch die Ausweitung des Schutzes von Migrant*innen und die Aufweichung der territorialen Definition von Staatsangehörigkeit beinhaltet. Es ist nicht ganz klar, inwieweit die Verwirklichung offener Grenzen die Abschaffung der Staats-bürgerschaft und eine revolutionäre Demontage des weltweiten Systems von Nationalstaaten erfordert. Solange es jedoch ein konstitutives „Wir“ gibt, über das sich die Bevölkerung eines Landes definiert, wird die Staatsbürgerschaft als Mitgliedsausweis in einem Club der Privilegierten dienen. Wir müssen deshalb dafür sorgen, dass mehr Menschen Zugang dazu haben. Eine gute und mehrheitsfähige Möglichkeit zur Umsetzung wäre es, den Geburtsort nicht mehr als das wichtigste Kriterium für die nationale Zugehörigkeit zu begreifen.
Tatsächlich war in der Frühzeit der USA der Geburtsort eher ein zweitrangiges Kriterium für die Staatsangehörigkeit. Im Einbürgerungsgesetz von 1790, in dem zum ersten Mal die Staatsbürgerschaft geregelt wurde, war diese auf Eingewanderte beschränkt, die freie weiße Personen mit „gutem Charakter“ waren. Den Ureinwohner*innen Amerikas, Versklavten, frei-en Schwarzen und Eingewanderten in Schuldknechtschaft blieben die Bürgerrechte also versagt. Diversen Gerichtsurteilen zufolge könnten Angehörige der indige-nen Völker, auch wenn sie auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten geboren wurden, keine Staatsbürger*innen sein, weil sie per Geburt Angehörige von außerhalb des US-Rechts stehenden Stämmen seien. In den USA geborene freie Schwarze waren ebenfalls von der Staatsbürgerschaft ausgeschlossen, weil Gerichte in den Südstaaten paradoxerweise argumentierten, dass der Geburtsort allein nicht zur Staatsbürgerschaft führe, sondern vielmehr der Besitz von Rechten und Privilegien.
Nach der Abschaffung der Sklaverei durch den 13. Zusatzartikel zur Verfassung verabschiedete der Kongress den Civil Rights Act von 1866, der den befreiten Sklav*innen Bürgerrechte gewährte: „Alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren sind und keiner ausländischen Macht unterstehen, mit Ausnahme der nicht besteuerten Indianer, werden hiermit zu Bürgern der Vereinigten Staaten erklärt.“ Um diese neue Sichtweise der Staatsbürgerschaft, die nun zu einer Angelegenheit des Bundes und nicht der einzelnen Bundesstaaten wurde, zu schützen, verabschiedete der Kongress 1868 den 14. Zusatzartikel, wo in Abschnitt 1 die Vorausset-zungen für die Staatsbürgerschaft festgelegt sind: „Alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert und ihrer Regierungsgewalt unterworfen sind, sind Bürger der Vereinigten Staaten und des Bundesstaats, in dem sie ihren Wohnsitz haben.“
Bis dahin war die Einbürgerung die verbreitetste Art gewesen, die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Die USA brauchten Einwander*innen, und die Einbürgerungspolitik spiegelte diese Notwendigkeit wider. Die Einstellung zur Staatsbürgerschaft begann sich jedoch ab Ende des 19. Jahrhunderts zu verschieben. Als die Nation sich selbst als autark begriff und der 14. Verfassungszusatz zunehmend als historisches Relikt erschien, begann eine erneute Mythologisierung des Geburtsortes als notwendige Voraussetzung für eine wahrhafte Zugehörigkeit zur Nation. Eingebürgerte mussten ihre Loyalität erst beweisen.
Nun sollen eingebürgerte Staatsbürger*innen Fähigkeiten und Kenntnisse belegen, die gebürtige US-Amerikaner*innen vielleicht nie besitzen werden. Die Einbürgerung ist ein langwieriges Verfahren. Um sich zu qualifizieren, muss ein*e Bewerber*in in den USA wohnen und nachweisen, Englisch lesen, schreiben und sprechen zu können. Er oder sie muss außerdem über solide Kenntnisse der Geschichte und des US-Regierungssystems verfügen. Für die Einbürgerung muss man darüber hinaus nachweisen, dass man „eine Person mit gutem moralischen Charakter ist, die sich den Prinzipien der Verfassung der Vereinigten Staaten verbunden fühlt“. Man kann sich leicht vorstellen, wie viele gebürtige US-Amerikaner*innen über Fragen wie „Was hat die Unabhängigkeitserklärung bewirkt?“ oder „Wie viele US-Senatoren gibt es?“ stolpern würden. Es fallen einem auch viele gebürtige US-Amerikaner*innen mit einem durchaus fragwürdigen „moralischen Charakter“ ein, darunter so manche Präsidenten.
Überdies laufen Eingebürgerte anders als gebürtige US-Amerikaner*innen auch Gefahr, ihre Staatsbürger-schaft zu verlieren. Sie können beispielsweise ausgebürgert werden, wenn die Regierung feststellt, dass sie bei ihrem Einbürgerungsantrag Fakten gefälscht oder verschwiegen haben, oder wenn sie sich einer Aussage vor dem Kongress verweigern. Eine Ausbürgerung ist auch möglich, wenn sich herausstellt, dass ein zuvor Eingebürgerter Mitglied einer terroristischen Organisation (wie der Nazi-Partei oder Al-Qaida) ist, oder wenn er unehrenhaft aus dem Militär entlassen wird.
Dies mag nach legitimen Gründen für die Aufhebung der Staatsbürgerschaft aussehen. Aber die Möglichkeit der Ausbürgerung wurde zunächst nicht nur als Strafe eingeführt. Durch eine Ausbürgerungsklausel im Einbürgerungsgesetz von 1906 sollte das Verfahren vereinfacht werden, da die Behörden nun unnötige oder fehlerhafte Einbürgerungen einfach annullieren konnten. Sobald es technisch möglich war, begann die Regierung jedoch, die Ausbürgerung für die gezielte Ausweisung unerwünschter Personen zu nutzen.
So wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einigen Frauen (sogar in den USA geborenen) die Staatsbürgerschaft aberkannt, nachdem sie Ausländer geheiratet hatten, ebenso wie Asiat*innen, deren „Rasse“ als „unamerikanisch“ galt. 1956 schlug US-Generalstaatsan-walt Herbert Brownell vor, Kommunist*innen durch den Entzug der Staatsbürgerschaft zu bestrafen. Als Reaktion darauf und angesichts der während der Nachkriegszeit weit verbreiteten Staatenlosigkeit plädierte die Philosophin Hannah Arendt für einen Verfassungszusatz zum Schutz der Staatsbürgerschaft. Sie, die selbst als staatenlose Geflüchtete aus Deutschland in die USA gekommen war, wusste nur allzu gut, wie leicht die Ausbürgerung zu einer totalitären Waffe werden kann, um Menschen aus dem Schutzbereich des Gesetzes zu drängen.
Schon Hannah Arendt forderte einen Verfassungszusatz zum Schutz der Staatsangehörigkeit von Eingebürgerten.
Selbst vermeintlich legitime Gründe für eine Ausbürgerung sind darüber hinaus oft schwer zu ermitteln. Im Juni 2018 kündigte die US-Einwanderungsbehörde USCIS die Einrichtung einer neuen Abteilung an, die teilweise schon Jahrzehnte zurückliegende Fälle von Einbürgerungsbetrug untersuchen soll. Das Interesse an solchen Fällen begann schon während der Präsidentschaft Obamas, als die Regierung das Fehlen der Fingerabdrücke von 13.000 Personen in einer zentralen Fingerabdruckdatenbank bemerkte. Die neue USCIS-Stelle wurde mit der Durchsuchung der Dateien beauftragt, um herauszufinden, welche Personen die Einbürgerung unter einem falschen Namen beantragt haben könnten.
Ein Mann namens Baljinder Singh war 2018 die erste Person, deren Einbürgerungsurkunde im Rahmen dieser Operation für nichtig erklärt wurde. Singh war 1991 durch einen Asylantrag unter dem Namen Davinder Singh in die USA gelangt. Nachdem er den Antrag zurückzog, sollte er abgeschoben werden, lebte aber weiterhin in den USA. Durch die Heirat mit einer US-Bürgerin erhielt er 2006 die Staatsbürgerschaft unter dem Namen Baljinder, ohne zu erklären, dass er einen Asylantrag unter einem anderen Namen gestellt hatte. Der Fall scheint ein eindeutiges Beispiel für Betrug zu sein. „Der Beschuldigte hat unser Einwanderungssystem ausgenutzt und sich unrechtmäßig den ultimativen Einwanderungsvorteil der Einbürgerung gesichert“, erklärte der zuständige Staatsanwalt Chad Readler. Aber es ist juristisch völlig offen, wie Singh das Einwanderungssystem „ausgenutzt“ haben soll. Ist die Tatsache, dass Singh den Abschiebungsbefehl nicht vorlegte, ein Beleg für seinen schlechten moralischen Charakter, sodass er nicht für eine Einbürgerung infrage kommt? Oder genügt schon das Verschweigen an sich, um ihn nicht einzubürgern?
Diese Fragen stellen sich auch bei anderen Ausbürgerungsverfahren, die allesamt zeigen, wie schwierig die Einordnung bestimmter Tatsachen in Einbürgerungsverfahren ist, beziehungsweise wann das Leugnen oder Verheimlichen dieser Tatsachen die Ausbürgerung rechtfertigt. In einem aktuellen Fall droht beispielsweise einem 62-jährigen Mann aus Florida, Parvez Manzoor Khan, die Ausbürgerung, ebenfalls mit der Begründung, er habe bei seinem Einbürgerungsantrag eine frühere Ausweisungsanordnung verschwiegen. Khan hielt dagegen, er habe von der Anordnung gar nichts gewusst. Er hatte nie die Hilfe eines Übersetzers erhalten, und sein Anwalt, dem im Übrigen später die Anwaltszulassung wegen Fehlverhaltens entzogen wurde, hatte es versäumt, ihn über seine Anhörung vor dem Einwanderungsgericht zu informieren. Sein jetziger Rechtsbeistand vertritt den Standpunkt, dass, selbst wenn ihm die damalige Anordnung bekannt gewesen wäre und er die Einwanderungsbehörde darüber informiert hätte, die juristische Relevanz dieser Ausweisungsverfügung für die Einbürgerung nicht eindeutig gegeben sei.
In einem ähnlichen Fall (Maslenjak vs. United States) wurde eine bosnische Serbin beschuldigt, bei ihrem Einbürgerungsantrag über die Aktivitäten ihres Mannes in der bosnisch-serbischen Armee gelogen zu haben. Als Maslenjak die Anerkennung als Geflüchtete beantragte, gab sie gegenüber einem Einwanderungsbeamten an, sie und ihre Familie seien Ziel von Verfolgung, weil ihr Mann sich der Einberufung in die Armee entzogen habe. Sie erhielt daraufhin Asyl. In ihrem späteren Antrag auf Einbürgerung erklärte Maslenjak unter Eid, dass sie niemals einen US-Einwanderungsbeamten belogen habe. Nachdem jedoch die Einwanderungsbehörde Beweise dafür vorlegte, dass ihr Mann in Wirklichkeit ein Offizier der bosnisch-serbischen Armee gewesen war, wurde Maslenjak wegen widerrechtlich erlangter Einbürgerung vor Gericht gestellt. 2014 wurde sie deswegen verurteilt, ihre US-Staatsangehörigkeit wurde aberkannt. Im Jahr 2017 hob der Oberste Gerichtshof die Entscheidung auf und wies den Fall an die Vorinstanz mit der Begründung zurück, es sei unklar, ob Maslenjaks Unwahrheit über ihren Ehemann für ihren Einbür-gerungsantrag „ausreichend relevant“ sei.
In solchen Fällen handelt es sich um ganz gewöhnliche Bürger*innen, die seit Langem in den USA leben. Ihr einziges „Verbrechen“ besteht darin, dass sie Regierungsbeamten bei ihrem Antrag auf Asyl oder Einbürgerung gewisse Informationen vorenthalten haben, die für ihren Einbürgerungsantrag relevant gewesen sein könnten. Die Beispiele zeigen, warum die Ankündigung der Einwanderungsbehörde einer aggressiveren Untersuchung von Betrugsfällen viele eingebürgerte US-Amerikaner*innen in Panik versetzte.
Was, wenn sie eine falsche Adresse auf ihrem Antrag eingetragen oder den dritten Vornamen ihrer Mutter nicht genannt hatten? Eine Freundin, die ihren ständigen Wohnsitz in den USA hatte und ihre Einbürgerung beantragen wollte, sorgte sich über eine drohende Abschiebung, sollte sie im Fall eines Umzugs vergessen, ihre neue Adresse innerhalb von zehn Tagen der Behörde mitzuteilen. Denn nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz ist dieses Versäumnis ein Vergehen, das mit Abschiebung geahndet wird.
Selbst wenn Abschiebungen ausgesetzt werden, wird die Ungleichbehandlung fortbestehen, solange die Option bestehen bleibt. Schließlich kann Angst, auch wenn sie ungerechtfertigt ist, das Verhalten mancher Menschen verändern. Auch wenn die Anträge der meisten Eingebürgerten in Wirklichkeit nie mehr untersucht werden, führt allein schon die Angst vor der Ausbürgerung dazu, dass die meisten von ihnen etwa ihr Recht, gegen die Regierung zu protestieren, möglicherweise nicht wahrnehmen.
Oder vielleicht wird ein*e Ausländer*in mit ständigem Wohnsitz in den USA sicherheitshalber überhaupt keinen Einbürgerungsantrag stellen und damit auf das Wahlrecht verzichten. Da die Möglichkeiten der Medien, diese Ängste zu zerstreuen, begrenzt sind, schließe ich mich an dieser Stelle der Forderung Hannah Arendts nach einem Verfassungszusatz zum Schutz der Staatsangehörigkeit von eingebürgerten Bürger*innen an. Es sollte nur eine Art von Bürger*innen in den Vereinigten Staaten geben: Bürger*innen.