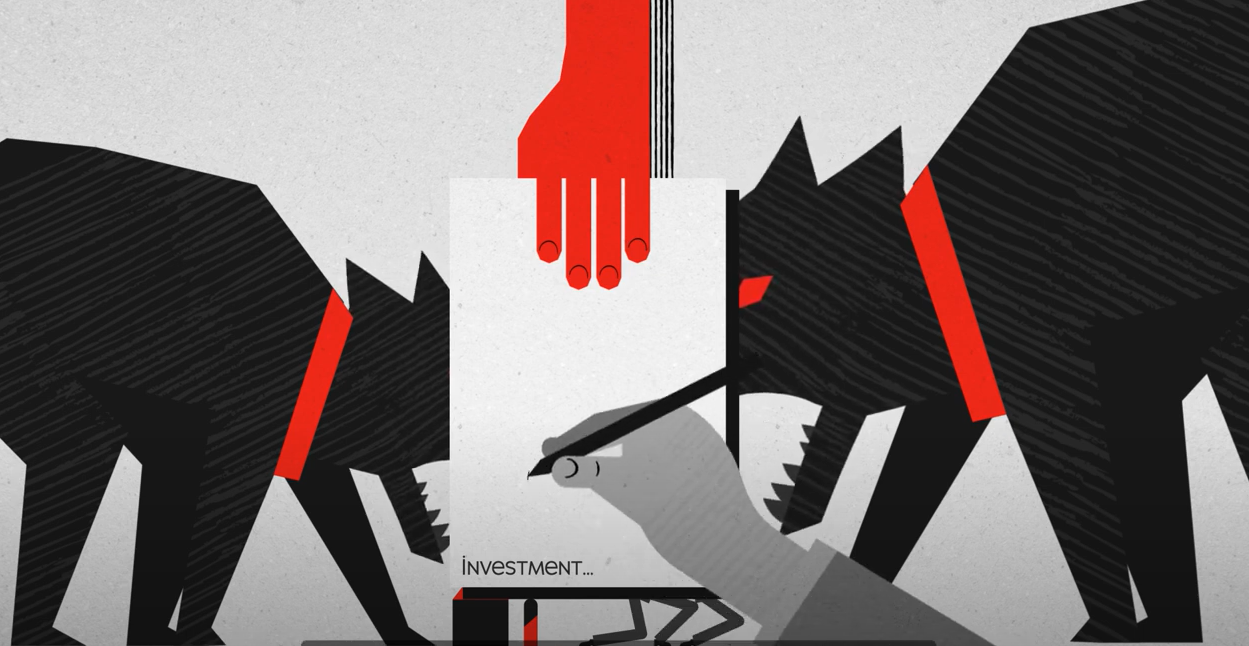Aktie Twitter Facebook Email Copy URL
Innerhalb weniger Tage sind die Preise für Weizen an der Chicagoer Börse stark gestiegen. Kommt eine globale Nahrungsmittelkrise auf uns zu?

Arbeiter*innen reinigen den Boden, während sich in einem Lagerhaus des Welternährungsprogramms (WFP) in Semera, Äthiopien, im Februar 2022 Säcke mit Lebensmitteln für die Regionen Tigray und Afar stapeln. Die Hilfsorganisation Oxfam International warnte im März 2022, dass der weit verbreitete Hunger in Ostafrika zu einer „Katastrophe“ werden könnte.
Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited
Die Lage ist kritisch
Seit 10 Jahren gibt es ein Krisenreaktionsforum des G20-Agrarmarktinformationssystems (AMIS), das auf bedrohliche Entwicklungen auf den Weltagrarmärkten schnell reagieren soll. Auch Deutschland ist Mitglied. Am 5. März fand erstmals eine außerordentliche Sitzung statt, das Forum ist in Alarmbereitschaft. Am Tisch saßen auch Russland und die Ukraine. Sie kamen darin überein, weiterhin verlässliche Agrarmarktdaten auszutauschen und Störungen des internationalen Agrarhandels zu vermeiden. Die Lage ist also sehr ernst.
Sind die Daten verlässlich?
AMIS soll verlässliche Daten liefern, genau dafür wurde es nach der Nahrungsmittelkrise 2008 gegründet. Gerade in Krisensituationen ist es wichtig, dass empirische Echtzeitdaten zur Höhe der globalen Lagerbestände vorliegen. Nicht nur um Preisspitzen bei Lebensmitteln vorherzusagen, sondern auch um zu bewerten, inwieweit die Weltagrarmärkte funktionieren und Versorgungsengpässe bewältigt werden können. Kaum ein Land führt jedoch empirische Erhebungen von Lagerbeständen umfassend durch. Die Philippinen und die USA sind rühmliche Ausnahmen, alle anderen führen diese wichtigen Erhebungen gar nicht – wie die EU – oder nicht umfassend durch. AMIS kann seinem Mandat so nicht gerecht werden.
Krisentreiber: Die Abhängigkeit vom Weltgetreidemarkt
Getreide wird größtenteils in dem Land angebaut, in dem es auch verbraucht wird. Das ist auch bei den Hauptgetreidearten der Fall. Bei Reis sind dies 91 Prozent der weltweiten Produktion, bei Mais 84 Prozent und bei Weizen 73 Prozent. Dennoch: Seit der Nahrungsmittelkrise 2008, welche bereits die Abhängigkeit vom Weltmarkt drastisch vor Augen geführt hat, stieg der Anteil des international gehandelten Getreides weiter an.
All jene Länder, die Getreide importieren, sind von wenigen Exportländern abhängig. 70 Prozent der Weizenexporte entfallen auf fünf Exportländer. Bei Mais decken vier Länder 85 Prozent der weltweiten Exporte ab. Der Anteil Russlands und der Ukraine an den globalen Exporten beträgt bei Weizen 26 Prozent und bei Mais 16 Prozent.
Die Abhängigkeit von wenigen Exportländern ist fatal: Wenn extremes Wetter dort zu Ernteverlusten führt, bewaffnete Konflikte den Anbau verhindern, Lieferketten zusammenbrechen oder politisch die Verwendung von Getreide für Biosprit gefördert wird, brechen die Exporte ein.
Ostafrikas Abhängigkeit vom Weltmarkt ist lebensbedrohend
Jede Krise ist anders, aber jede Krise zeigt, wie lebensbedrohend die Abhängigkeit vom Weltmarkt sein kann. Dies bekommen auch die hoch verschuldeten Regierungen afrikanischer Länder zu spüren. Die Länder Ostafrikas – Äthiopien, Somalia, Kenia, Südsudan – importieren bis zu 90 Prozent ihres Weizens aus der Ukraine und Russland. Steigende Getreidepreise verstärken den bestehenden Hunger. Bis zu 28 Millionen Menschen sind in Ostafrika von extremem Hunger bedroht. In anderen Ländern wie Ägypten, Algerien, Tansania und Pakistan wird aktuell wegen der hohen Weizenpreise weniger importiert als sonst.
Ist die Getreideversorgung global gefährdet?
Wichtig ist, wie hoch die Lagerbestände sind. Denn ihre Freigabe kann schlechte Ernten in anderen Ländern sowie den Wegfall von Exporten abfedern. Die weltweiten Lagerbestände sind bei Weizen und Mais üppig (falls die Daten stimmen). Das Verhältnis von globalen Lagerbeständen zum globalen Verbrauch („stock-to-use ratio“) liegt bei Weizen aktuell bei 35 Prozent und damit weit über der kritischen Grenze von knapp 20 Prozent. Selbst wenn man die Bestände von Russland und Ukraine herausrechnet, liegt dieser Wert in Hauptexportländern immer noch bei 28 Prozent!
Andere verweisen auf das Verhältnis der Lagerbestände in Hauptexportländern zu ihrem Verbrauch und ihren Exporten („stock-to-disappearance ratio“). Das heißt, Exporte werden implizit als nicht gesichert angesehen und die mit Datenunsicherheiten behafteten Lagerbestände von China bleiben unberücksichtigt. Bei Weizen liegt dieser Wert nahe an der kritischen Grenze von 13 Prozent. Sind diese Werte jeweils niedrig, steigen die Preise bzw. die Preisschwankungen. Meine Einschätzung ist: Die derzeitige Lagersituation ist insgesamt noch nicht besorgniserregend. Das heißt, es gibt im Moment Getreide, aber es ist teuer.
Preisentwicklung ist schwer vorhersehbar
Mit wesentlich mehr Unsicherheiten ist die Einschätzung zukünftiger Entwicklungen verbunden. Aktuell sinkt beispielsweise der Ölpreis wegen des Lockdowns in Shanghai, doch wird es so bleiben? Wenn keine weiteren Ernte- oder Exportausfälle eintreten und die Öl- oder Energiepreise nicht erneut sprunghaft ansteigen, ist davon auszugehen, dass die Preise sich im Vermarktungsjahr 2021/22 auf dem jetzigen Niveau einpendeln.
Für das Jahr 2022/23 hängt die Entwicklung der Preise davon ab, wie sich andere Exportländer, Landwirt*innen und Wirtschaftsakteure verhalten. Es gibt erste Hinweise dafür, dass es Anpassungen geben wird. Indien will mehr Weizen exportieren, der Düngemittelkonzern Nutrien seine Kali-Produktionskapazitäten ausbauen. Wegen der Trockenheit werden Exportrückgänge bei Winterweizen in den USA erwartet, nicht jedoch bei Mais und Soja. Agrarexperten gehen aktuell davon aus, dass die globale Getreideproduktion mindestens um 10 Millionen Tonnen niedriger ausfällt und damit auch die Lagerbestände sinken. Das heißt, die Versorgungslage wird schlechter werden.
Wie haben sich die Lebensmittelpreise entwickelt?
Die Getreidepreise stiegen seit Anfang 2020, der Lebensmittelpreisindex der Welternährungsorganisation überschreitet seit Oktober 2020 den Wert von 100. Im Dezember 2021 ist der Index so hoch wie im März 2008 und im Februar 2022 erreicht er einen neuen Höchststand. Wesentliche Preistreiber sind zuletzt pflanzliche Öle und Milch. Bei pflanzlichen Ölen ließen die knappe Sojabohnenernte in Südamerika, Ernteprobleme bei Palmöl in Malaysia und die stark gestiegene Verwendung von Palm- und Sojaöl für die Biodieselproduktion die Preise steigen.
Der Beginn des Ukraine-Konflikts hat die Preissituation nochmals zugespitzt. Innerhalb weniger Tage sind die Preise für Weizen an der Chicagoer Börse um 50 Prozent gestiegen. Die Preisschwankungen sind hoch, sowohl bei Öl als auch bei Getreide. Nach dem Verhandlungstreffen zwischen Russland und Ukraine am 29.03.2022 ist der Weizenpreis wieder gefallen.
Spielt Nahrungsmittelspekulation eine Rolle?
Das Verhalten von Finanzspekulanten wird wesentlich von Erwartungen und der Sorge um mögliche Versorgungsengpässe bestimmt. Steve Suppan vom Institut für Agrar- und Handelspolitik (IATP) beobachtet, dass in den USA die exzessive Spekulation an den Börsen die Weizenpreise hochgetrieben hat. Seiner Meinung nach sind die Daten der US-Überwachungsbehörde CFTC nicht mehr aussagekräftig, seit Präsident Trump im Oktober 2020 die Regeln für die Begrenzung von Nahrungsmittelspekulation aufgeweicht hat. Die Obergrenzen sind jetzt höher und die Börsen entscheiden nunmehr selbst, welche Termingeschäfte sie auf die Obergrenzen („Positionslimits“) anrechnen.
Für die exzessive Spekulation spricht laut Suppan, dass der Weizenpreis am Ende der Vertragslaufzeit der Termingeschäfte nicht auf der Höhe des Marktpreises liegt. Agrarhändler profitieren von den Preisschwankungen, sie können viel Geld verdienen. Wegen hoher Nachforderungen bei der Hinterlegung von Sicherheiten („Margin Calls“) müssen sie nun allerdings neues Kapital auftreiben, um das Geschäft am Laufen zu halten. Eine weitere Konzentration könnte die Folge sein.
Welche Folgen hat ein Anstieg der Lebensmittelpreise in wirtschaftlich benachteiligten Ländern?
Jede Preiskrise zeigt erneut, dass „Food First“ ein frommer Wunsch in Krisenzeiten ist. Die Nachfrage nach pflanzlichen Ölen für Biodiesel treibt die Preise in die Höhe. Ethanol-Produzenten in der EU suchen händeringend Getreide. Tierbestände lassen sich nicht ohne weiteres kurzfristig reduzieren. Politisches Versagen beim Umbau der Tierhaltung, bei der Abkehr von der erdölbasierten Landwirtschaft und der Agrospritpolitik sowie bei der Regulierung der Warenterminmärkte feuert die Konkurrenz zwischen Teller, Trog und Tank und die Preisschwankungen bei Lebensmitteln an.
Steigen die Lebensmittelpreise stark an, trifft dies Menschen in (extremer) Armut besonders hart. In Somalia sind die Preise für Grundnahrungsmittel mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. In Kenia muss sich die Hälfte aller Haushalte Lebensmittel leihen oder auf Kredit kaufen. Können Sie sich das vorstellen? Im Zuge einer Oxfam-Recherche zur Lebensmittelkrise im Jahr 2008 bringt es eine befragte Person auf den Punkt: „Es ist, als wenn man täglich dem Tod ins Auge sieht“.
Die offiziellen Daten zur Preisentwicklung vor Ort beziehen sich häufig auf Großhandelspreise und nicht auf die Einzelhandelspreise. Die Menschen glauben, dass die Lebensmitteleinzelhändler die Preise unabhängig von den zugrunde liegenden Kosten erhöhen können und dies auch tun. Das Machtungleichgewicht in der Lebensmittelkette trägt zu „Asymmetrien bei der Preisübertragung“ bei. Das heißt, die Inlandspreise steigen, wenn es externe Schocks gibt, aber sie fallen nicht gleich wieder, wenn sich die Situation entspannt hat. Gewinne werden vom Lebensmittelhandel abgeschöpft.
Was ist zu tun?
Die Frage ist nicht, ob es eine globale Nahrungsmittelkrise gibt, sondern wie sehr sie sich verschärft. Die Hungerzahlen steigen seit 2014. Aktuell hungern weltweit etwa 811.000.000 Menschen. Stellen Sie sich vor, alle Menschen in der EU und den USA würden hungern. Das wäre eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes.
Und dennoch, die Politik reagiert weitestgehend gleichmütig auf diese Zahlen, solange keine Unruhen und Aufstände drohen. Während der COVID-19-Krise gab es kein außerordentliches Treffen des Welternährungsausschusses, obwohl die Situation verheerend war. Auch der Welternährungsgipfel im September 2021 hat das Ziel deutlich verfehlt, die längst überfällige Trendwende einzuleiten.
Corona-bedingt konnten sich zusätzliche 320 Millionen Menschen kein gesundes Essen leisten, insgesamt sind es sogar nahezu 2,37 Milliarden Menschen. Das sind 30 Prozent der Weltbevölkerung! Statt agrarökologische Ansätze zu fördern, folgt die EU der Agrarlobby, die ökologischen Vorrangflächen freizugeben und Hilfen auch für die Produktion von Mineraldünger bereitzustellen. Es ist zum Verzweifeln!
Wichtig ist jetzt unter anderem:
- Jetzt Leben retten: Die Bundesregierung sollte neue Mittel für humanitäre Hilfe und Appelle zur Ernährungssicherheit weltweit bereitstellen. Im Haushaltsentwurf 2022 ist unverständlicherweise eine Reduzierung der BMZ-Gelder für das Welternährungsprogramm um 43,98 Prozent vorgesehen.
- Treffen des Welternährungsausschuss einberufen: Die Bundesregierung sollte sich in Rom dafür einsetzen, dass ein Sondertreffen des Welternährungsausschuss zur Ernährungssituation abgehalten wird.
- Universellen sozialen Schutz gewährleisten: Um allen den Zugang zu angemessener und ausreichender Nahrung sicherzustellen, sind rechtebasierte, universelle soziale Sicherungssysteme unabdingbar. Die Bundesregierung sollte sich für einen globalen Fonds für soziale Sicherheit einsetzen.
- Ernährungssysteme mit Agrarökologie umgestalten: Die Bundesregierung sollte resiliente Ernährungssysteme fördern, indem sie agrarökologische Ansätze und damit auch die Entwicklung lokaler und regionaler Lebensmittelversorgungsketten unterstützt. Eine Abkehr von der erdölbasierten Landwirtschaft ist drängender denn je. Das heißt, mehr biologische Vielfalt über und unter der Erde, den Anbau von stickstoffbindenden Eiweißpflanzen (Leguminosen), Agroforstsysteme und den Einsatz von Bio-Düngemitteln fördern. Auf der EU-Ebene sollte die „Farm-to-Fork“-Strategie vorangetrieben werden.
Marita Wiggerthale ist Senior Policy Advisor für Welternährung und globale Landwirtschaft bei Oxfam Deutschland. Dieser Artikel erschien ursprünglich auf dem Blog von Oxfam Deutschland. Übersetzt von Jan Urhahn.